Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte & GRK 2196 nicht besetzt | 4.8.-15.8.
Sekretariat für Mittelalterliche Geschichte & GRK 2196 nicht besetzt | 4.8.-15.8.

Herbipolis – diesem schwierigen Wort sahen sich im April 2024 einige Studierende der Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal gegenüber, als sie unter der Leitung von PD Dr. Arne Karsten eine Exkursion ins beschauliche Würzburg unternahmen, um sich mit der Kunst- und Kulturförderung der geistlichen Reichsfürsten im 18. Jahrhundert zu beschäftigen, jener Fürstbischöfe aus dem Hause Schönborn, deren Wirken bis heute als „Schönbornzeit“ im kulturellen Gedächtnis Frankens präsent ist.
Am ersten Abend wurden die Grundlagen der Exkursion gelegt: Ausgehend von der Alten Mainbrücke erkundeten wir das nähere Main-Umland, wie auch die Erzeugnisse der daran gelegenen Weinberge. Nach kurzem Spaziergang - endlich sesshaft geworden - setzte Dozent Arne Karsten kulinarisch den ersten Spatenstich. So mancher Student griff sodann zum fränkischen Schäufele, um ihm beizuspringen. Bei sommerlichen Temperaturen ließen wir so den ersten Abend ausklingen, mit Blick auf die Stadt, den Main und den berühmten Würzburger Stein.
Am nächsten Morgen wanderten wir von der Alten Mainbrücke aus auf der Würzburger Machtachse dem Dom entgegen. Auf dessen Rückseite befand sich die erste Station des Tages: die Fassade der Schönbornkapelle. An dieser Stelle tauchten dann sogleich zwei Motive auf, welche die Exkursionen der Frühen Neuzeit an der BUW immer mal wieder begleiten: die Fassaden von Häusern und Kirchen sowie die Baugerüste, welche die Fassaden vor den Augen der Studierenden verbergen. Davon jedoch nicht abgeschreckt, ging es auf der Schönborn-Machtachse in gerader Linie zu der barocken Residenz der Fürstbischöfe von Würzburg.
Nachdem dieses Mal die Fassadenbeschreibung erfolgreich verlief, ging es in die Residenz hinein und eine von Kanonenkugeln auf Herz und Nieren geprüfte Treppe hinauf, in die bischöflichen Empfangs- und Repräsentationsräume. Hier stellten wir fest, dass die französisch anmutende Fassade von einem italienisch anmutenden Barock im Inneren abgelöst wurde. Der Rundgang endete mit einem Blick in die Hofkirche – die vielleicht „barockste“ Kirche Deutschlands.
Nächster Tagesordnungspunkt war eine Führung durch den Dom und das Neumünster. Es ging um Grabmäler, Kriegszerstörung, ermordete Bischöfe und natürlich die Grafenfamilie Schönborn – alles sachkundig und charmant präsentiert. Vom Dom aus führte uns ein literarisch begleiteter Spaziergang entlang an frühneuzeitlichen Meisterwerkstätten, Kaufhäusern, dem möglichen Grab Walters von der Vogelweide zuletzt hin zur Marienkapelle. Diese Kirche, welcher der Begriff der „Kapelle“ nicht wirklich gerecht wird, ist ein stolzes Baudenkmal des Würzburger Stadtpatriziats und schloss das Thema der Kirchen ab – zumindest für diesen Abend. Von da aus ging es (mit kleinem Abstecher in das sonnige Blütenmeer der Residenzgärten) ins Würzburger Bürgerspital. Hier wurde dann, in geradezu minutiöser Kleinarbeit, die Qualität der zum Spital gehörenden Weinproduktion, natürlich wissenschaftlich fundiert, untersucht. Nicht nur der Wein, auch das Essen fand großen Gefallen und so ist es wenig verwunderlich, dass der Tag in Heiterkeit und Harmonie ausklang.
Am nächsten Morgen ging es dann abermals hinein in die Geschichte Würzburgs, ausgehend von – wie könnte es anders sein – der Alten Mainbrücke. Hier stand das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Fürstbischof auf dem Programm. Um dieses näher zu ergründen, machten wir uns furchtlos auf den Weg hinauf zur Festung. Diese liegt, nur durch den Main und die Alte Mainbrücke getrennt, der Stadt auf einem Berg gegenüber.
Oben in der Festung angekommen, bot sich uns nicht nur ein imposanter Ausblick auf die Stadt, sondern auch ein interessanter Einblick in die Festungsarchitektur der Frühen Neuzeit. In Würzburg treffen mittelalterliche Burgmauern auf gewaltige Festungswälle. Diese sind optimal, um Angriffen (egal ob auf oder aus der Stadt) standzuhalten. Während dieses Monument geballten Willens und hochentwickelter Baukunst noch immer an Ort und Stelle verweilte, war es für uns jedoch nun Zeit zum Aufbruch. Noch ein letzter Blick über die Stadt, und es ging heim nach Wuppertal und dem nächsten Semester entgegen.
Eneas Uhlemann

Im Rahmen zweier Seminare der Wissenschafts- und Technikgeschichte zu den Themen „Klima“ und „Wasser“ ging es für unsere Seminarleiterin Frau Jun.-Prof. Dr. Dania Achermann und zehn Studierende vom 03.12. bis zum 06.12. in den Norden der Bundesrepublik. Begleitet wurden wir von didaktischer Expertise in Person von Frau Christine Dzubiel sowie von Frau Achermanns Doktoranden Jan Nicolay.
Die Abschiedsexkursion (Frau Achermann wird uns leider bald verlassen) machte Halt in Bremerhaven, Bremen und Hamburg und hatte verschiedenste spannende Programmpunkte zu bieten, die auf den ersten Blick untypisch für eine Exkursion der Historischen Fachgruppe erscheinen. Nachdem der Sonntag als reiner Anreisetag nach Bremerhaven genutzt wurde, ging es für unsere Gruppe am Montag nach einem gemeinsamen Frühstück gestärkt in Richtung des Forschungsdepots des „deutschen Schifffahrtsmuseums“. Dort erwartete uns bunt zusammen gewürfelte Truppe bereits die erste didaktische Herausforderung, bevor der eigentliche thematische Einstieg stattfand. Mithilfe eines ausgeklügelten Bingos sollten wir uns alle ein wenig besser kennenlernen. Nach dieser spielerischen Form des Kennenlernens wurden wir von zwei Herren in die Geschichte des Schifffahrtmuseums sowie die Funktion des Depots eingeführt. Wir hatten das Glück, von diesen beiden Experten (Dr. Sven Bergmann, Dr. Frederic Theis) eine ausgiebige Privatführung durch die „Lagerhalle“ eines Museums zu bekommen und durften uns an vielen Schätzen der Seefahrt erfreuen (von Modellen über Inventar von diversen Schiffstypen bis hin zu technischen Überbleibseln aller Art). Der Programmpunkt schloss mit Vorträgen der beiden Wissenschaftler zu ihren Forschungsgebieten ab, sodass wir das Depot gegen 14 Uhr mit viel neuem Wissen, insbesondere zum Themengebiet der maritimen Kartographie, verließen. Der zweite Tagespunkt führte die Exkursionsgruppe ins „Klimahaus“, in welchem die Besucher*innen die Welt am 8. Längengrad entlang entdecken und dabei das Klima und die Kultur verschiedener Länder kennenlernen können. Trotz des teilweisen starken Bedienens von landestypischen Klischees, bereitete uns der Gang durch die geographischen Mikrokosmen viel Freude. Mit der Erkenntnis, dass in der Schweiz anscheinend außerordentlich viel gejodelt und gejauchzt wird, beendete die Gruppe den ersten Tag bei einem gemeinsamen Abendessen in einer kleinen durch ihre Qualität bestechenden Pizzeria.
Der zweite Tag führte uns wieder etwas gen Süden nach Bremen, wo wir am späten Vormittag eine Führung im Sedimentbohrkernlager des „Marums“ der Universität Bremen bekamen. Diese didaktisch grandiose Führung durch eines von nur drei (!) dieser Lager weltweit beinhaltete eine Vorstellung des Instituts und dessen Arbeit, gerade in Bezug auf die Bohrkernforschung. Von der Begeisterung des uns zur Seite gestellten Experten, Dr. Holger Kuhlmann, angesteckt, wurden wir in die Lagerhalle geführt, in der mehrere tausende Bohrkernproben der letzten 40 Jahre, u.a. aus dem Atlantik, aufbewahrt werden. Das Highlight der Führung war für die Gruppe die Ausstellung von vier dieser Sedimentbohrkerne. Neben der intensiven Begutachtung durch uns Laien wurden wir mit ausführlichen Erklärungen zu Alter, Aussehen etc. gefüttert. Einer dieser Bohrkerne stammte aus dem Rand des berühmten „Chicxulub-Kraters“ im Golf von Mexiko und faszinierte uns wegen seiner Beschaffenheit in besonderer Weise. Mit erneut viel dazugewonnenem Wissen im Gepäck ging die Reise gegen 14 Uhr weiter nach Hamburg, wo wir nach einigen wetterbedingten Schwierigkeiten gegen 17 Uhr während des norddeutschen Schneetreibens einen Vortrag vom Leiter des Klimarechenzentrums, Prof. Dr. Thomas Ludwig, zu dessen Arbeit und Funktion hören durften. Anschließend gab es als Schmankerl für die Technikfreund*innen unter uns, dass wir in den dortigen Computerraum geführt wurden, welcher den 74-stärksten Rechner (bestehend aus 3.000 kleinen Computern) der Welt beherbergt. Dieser Superrechner modelliert die Klimamodelle für die Institution. Den zweiten, aufgrund des vielen Reisens und der diversen Eindrücke doch anstrengenden Exkursionstag, beendeten wir wieder mit einem gemeinsamen Abendessen bei einem ebenso durch seinen Geschmack bestechenden Italiener.
Der Abschluss der Exkursion führte uns am Mittwochmorgen zu den Hamburger Landungsbrücken, wo uns ein Experte für Hochwasserschutz für eine Sturmfluttour erwartete. Diese war zumeist ein schöner, wenn auch langwieriger mit Infos zu den Hamburger Sturmfluten gespickter Spaziergang durch das verschneite Hamburg. Dem pensionierten Verwaltungsexperten Michael Schaper war sein bauingenieurlicher Hintergrund anzumerken, der einen anderen Blick auf die Hafen- und Deichanlagen anbieten konnte. Dennoch bot uns diese Tour viele Interessante Einblicke in die Hochwassergeschichte der Stadt. Der letzte Programmpunkt unserer Reise war um 14 Uhr der Besuch des „Internationalen Maritimen Museums“. Aufgrund der begrenzten Zeit (einige der Studierenden fuhren bereits gegen 17 Uhr zurück) konnte das eindrückliche Museum nicht in Gänze bewundert werden, jedoch hinterließ es bei allen einen sehr positiven Eindruck. Von Schifffahrt in der Kunst über Waffen und Uniformen der Marine bis hin zu maritimen Schwerpunkten wie dem U-Boot-Kosmos bot das Museum ein spannendes Sammelsurium von den Anfängen der maritimen Fortbewegung bis in die heutige Zeit. Sichtlich erschöpft von den Tagen und so vielen neuen Informationen reflektierten wir im Foyer des Museums die vergangenen Tage und zogen ein äußerst positives Feedback, bevor die Gruppe auseinanderging und auf den verschiedensten Wegen die Heimreise antrat.
Die Exkursion war aufgrund ihres vielseitigen und teilweise eher naturwissenschaftlichen Schwerpunkts eine spezielle Exkursion der historischen Fachgruppe. Dennoch konnten durchweg Bezüge zu den beiden Seminaren gemacht werden, sodass die gemeinsame Reise einen passenden Abschluss für die Veranstaltungen und für Frau Achermann hoffentlich einen würdigen Abschied von unserer Bergischen Universität darstellte.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die schönen und spannenden gemeinsamen Tage!
Johannes Höffgen

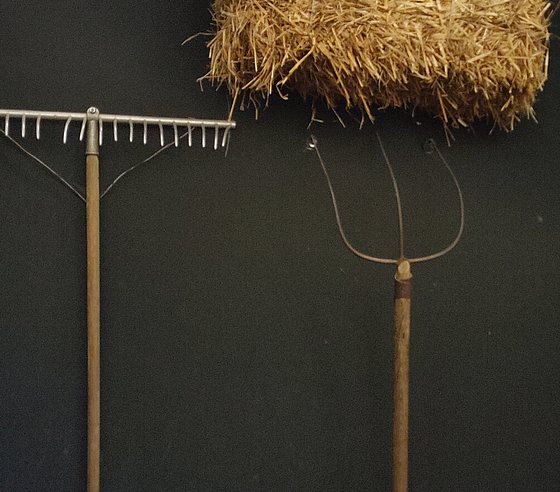

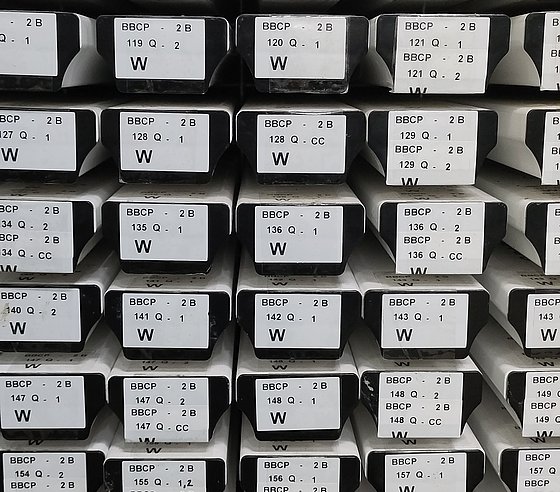






In Dortmund, Altena, Grünewald und Siegburg, tauchten wir tief in die Welt der mittelalterlichen Weihnachtsmärkte ein. Unter der Leitung von Frau Dzubiel und im Rahmen des Didaktik Seminars "Mittelalterliche Weihnachtsmärkte als geschichtskulturelles Phänomen" setzten wir uns nicht nur intensiv mit den Aspekten und Kriterien von Ökonomie (Geschichtstourismus) und Authentizität auseinander, sondern organisierten anschließend auch die dazugehörigen Exkursionen.
Auf unserer Tour durch die mittelalterlichen Weihnachtsmärkte wurde klar, dass jeder Ort und jeder Anbieter auf je eigene Weise versucht, Mittelalterliches erlebbar zu machen.
Die intensive Auseinandersetzung mit den ökonomischen und Authentizitätkriterien ergab, dass diese in komplexen Beziehungen stehen. So legt jeder Markt andere Schwerpunkte und eine Kommerzialisierung bedeutet nicht unbedingt einen Verlust an Authentizität - und umgekehrt.
Die Vielfalt, die es auf den Märkten gab zeigte uns deutlich, dass der Aspekt des Mittelalters sehr facettenreich und individuell sein kann, .- aber nicht muss.
Sabrina Ottersbach

Geschäftiger Umschlagplatz für den Levantehandel, Machtzentrum im Mittelmeer und Sehnsuchtsort aller Italienreisenden: Das einzigartige Venedig war vieles in seiner glanzvollen und über 1000-jährigen Geschichte. In der letzten Septemberwoche dieses Jahres jedoch wurde die Serenissima auch Herberge einer Gruppe wissbegieriger Wuppertaler Studierender. Unter der Leitung PD Dr. Arne Karstens wandelten sie vier Tage lang durch die Gassen der Lagunenstadt und befuhren ihre Kanäle auf den vaporetti, den lokalen Wasserbussen.
Der erste Tag stand unter dem Stern der Erinnerungskultur. Hauptobjekte der Begierde waren die Kirchen der beiden großen Bettelorden: die franziskanische Santa Maria Gloriosa dei Frari und die dominikanische Santi Giovanni e Paolo (im venezianischen Dialekt „San Zanipolo“). Hier ließen sich nicht nur die Praktiken zeitgebundener Erinnerungskultur veranschaulichen, sondern auch die Um- und Neudeutung von Geschichte plastisch nachvollziehen. Überdies ermöglichte es das Thema, auch andere Gelegenheiten am Wegesrand mitzunehmen, wie etwa die seltene Möglichkeit, die sonst verschlossene Kirche San Lazzaro dei Mendicanti zu betreten, „weil heute glücklicherweise eine Beerdigung stattfindet“. “. Eines der Highlights war eine Visite im Deutschen Studienzentrum Venedig, das im Palazzo Barbarigo della Terrazza beherbergt ist. Neben dem Genuss einer Auszeit auf der namengebenden Terrasse mit wundervollem Blick auf den Canal Grande konnten die Studenten hier einen Einblick in den Wissenschafts- und Kulturbetrieb des Studienzentrums durch ein nettes Gespräch mit dem jüngst ins Amt eingeführten Direktor PD Dr. Richard Erkens gewinnen.
Nach gruppenstärkendem abendlichen Kochen, Speisen und Spritzgenießen in den herrlichen Gemäuern des ehemaligen Jesuitenklosters und heutigen Hostels „Combo“ ging es tags darauf sogleich weiter mit einem Besuch des Dogenpalastes. Herrschaftsorganisation und Selbstdarstellung waren die Leitbegriffe, welche die Auseinandersetzung mit dem Zentrum der Republik strukturieren sollten. Die demonstrative Offenheit des Gebäudes und das Bildprogramm der Gerechtigkeit standen dabei im scharfen Kontrast zu den heutigen Bediensteten, die unwirsch das Nutzen von Headsets forderten, welche dann nicht mehr ausleihbar waren. Die Gruppe ließ es sich dennoch nicht nehmen, in akribischer Arbeit die in Allegorien ausgebreitete Selbstdarstellung und Funktion der verschiedenen Gremien und Organe zu analysieren, die die über Jahrhunderte in ganz Europa bewunderte Verfassung der Serenissima ausmachten. Ein geselliger Abend beim eigens vom Chefkoch der „Antica Adelaide“ zusammengestellten Menü entschädigte dann aber die ausgelaugten Geister und revitalisierte die müden Beine, sodass bester Laune der dritte Tag angegangen werden konnte.
Dieser wartete mit einem Glanzlicht der europäischen Malerei auf. In der Scuola Grande di San Rocco bestaunten die Studierenden ein Ensemble, das über ein Vierteljahrhundert vom venezianischen Altmeister Jacopo Tintoretto erdacht und gemalt worden war. Die Vielzahl der subtilen Anspielungen und Querverweise begeisterten ebenso wie die markante Handschrift des manieristischen Künstlers, der hier den Geltungsanspruch der Laienbruderschaft sinnfällig in Szene setzte. Am Nachmittag betätigte sich die Truppe schließlich beim Laienschauspiel in der Darstellung der Schlacht von Lepanto – diesmal am Lido, dem venezianischen Naherholungsgebiet und Strand an der Adria.
Zu guter Letzt rückte am vierten Tag die ruhmreiche maritime Tradition der Venezianer mit einem Besuch des Museo Storico Navale in den Fokus. Galeerenkampf und Kanonendonner konnten danach nur noch von der anschließenden Besichtigung des vom italienischen Militär streng abgeschirmten Arsenales, die unter den Argusaugen eines italienischen Marine-Leutnants durchgeführt wurde, überboten werden. Zwar überstrahlte die Arbeitsmoral der Wuppertaler diejenige der italienischen Soldaten, doch war dies in einer so glücklichen Konstellation von altgedienten und jungen Studierenden auch nicht anders zu erwarten. Den krönenden Abschluss fand die rundum gelungene Exkursion in einer Betrachtung des Denkmals zu Ehren Vittorio Emanueles II. aus der Zeit des italienischen Risorgimento auf der Riva degli Schiavoni. Hier verband die Gruppe die Leitmotive der Erinnerungskultur und Herrschaftsrepräsentation, der venezianischen Stadtgesellschaft und der venezianisch-italienischen Militärgeschichte zu einem geistreichen Schlusspunkt.
Jonathan Huppertz



Mit über 2,3 Millionen Besucher*innen pro Jahr gehört das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau, am historischen Ort des größten Konzentrations- und Vernichtungslagers, zu der bekanntesten und meistbesuchten KZ-Gedenkstätte überhaupt. Unter der Leitung von Prof.’in Dr. Juliane Brauer und Dario Treiber vom Arbeitsbereich Geschichte und ihre Didaktik unternahmen 15 Studierende der Fachgruppe Geschichte der Bergischen Universität im Zeitraum vom 18. bis zum 24. August 2023 eine außergewöhnliche Exkursion genau an diesen Ort. Das Besondere an diesem Format war, dass die Studierenden von 25 Schüler*innen der Stufe 10 des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums begleitet wurden. Ziel der Exkursion war es, den Studierenden wie auch den Schüler*innen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte des Holocaust zu ermöglichen und innovative Ansätze der Gedenkstättenpädagogik auszuprobieren. Für uns Studierende bestand das Ziel der Exkursion darin, eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Gedenkstättenpädagogik vorzubereiten und die Möglichkeit zu erhalten, vorzeitig in die Rolle von Lehrenden zu schlüpfen. Dabei sollten wir nicht nur historisches Wissen erwerben, sondern auch Fähigkeiten entwickeln, um dieses Wissen an Schüler*innen im Rahmen von gedenkstättenpädagogischen Workshops weiterzugeben und auf eine innovative, zeitgemäße und emotional wie auch inhaltlich angemessene Weise zu vermitteln.
Nichts geht ohne Vorbereitungen
Während die Planung und Organisation insgesamt über anderthalb Jahre in Anspruch nahmen, wurden wir Studierende im Laufe des letzten Sommersemesters intensiv auf die Exkursion vorbereitet: Wir, das sind 15 Studierende der Geschichte unterschiedlicher Fachsemester, Erfahrungsgrade und Perspektiven auf die Disziplin. Viele von uns – aber nicht alle – planen in Zukunft auch als Lehrkräfte zu arbeiten. Da die Vermittlung von Geschichte auch in außerschulischen Berufsfeldern hohe Relevanz hat, waren unsere Motivationen zur Teilnahme ebenso vielfältig, denn die Exkursion versprach für uns alle ein großer Gewinn zu sein.
Im Rahmen eines Hauptseminars und einer Block-Übung erlangten wir nicht nur Einblick in gedenkstättenpädagogische Grundlagen und Diskussionen, Basiswissen zum historischen Ort Auschwitz und Reflexionsmethoden, sondern konnten die Zeit nutzen, um uns in Dreierteams zu finden, Themen, Fragestellungen und Methoden auszuhandeln. Bereits während des Sommersemesters kam es auch zu einem ersten Kennenlernen zwischen Studierenden und Schüler*innen: Hier konnten erstere ihre geplanten Workshops bewerben und letztere nach ihren Interessen entscheiden, sich den Gruppen zuordnen und Kontaktdaten auszutauschen.
Oświęcim, die Workshops und der Aufenthalt
Die Exkursion startete am 18. August mit einer Übernachtfahrt im Reisebus nach Oświęcim, Polen. Am Tag unserer Ankunft blieb uns daher noch genügend Zeit, in Ruhe unsere Zimmer zu beziehen und die Altstadt zu erkunden.
Der inhaltliche Part der Exkursion begann ab dem nächsten Tag mit deutschsprachigen Führungen durch die Gedenkstätte Auschwitz I und Auschwitz-Birkenau. Da Gruppenbesuche in der Gedenkstätte nur mit in Begleitung hauseigener, offizieller Guides gestattet sind, wurden wir in je zwei gemischten Gruppen über die Gelände des ehemaligen Stammlagers und Birkenau geführt. Trotz unterschiedlicher Ansätze waren die Führungen bemerkenswert lang und dicht, sodass neben einigen Informationen zum historischen Ort und dem Einblick in die Architektur der Gedenkstätte die Rundgänge auch die Gelegenheit boten, gedenkstättenpädagogische Entscheidungen und erinnerungspolitische Narrative, die sich uns präsentierten, zu rezipieren. Die Führung durch Birkenau endete am Internationalen Mahnmal für die Opfer des Faschismus von 1967, an dem sich die gesamte Gruppe für eine gemeinsame Gedenkminute einfand. Die offiziellen Führungen durch die Gedenkstätten Auschwitz I und Birkenau wurden für die Schüler*innen durch fünf gedenkstättenpädagogische Workshops ergänzt. Pro Workshop arbeiteten drei Studierende mit fünf bis sechs Schüler*innen an vier aufeinanderfolgenden Tagen zusammen, um eines der folgenden Themen produktorientiert zu bearbeiten:
Im Workshop „Von Orten des Terrors zu Orten der Erinnerung“ erstellten die Teilnehmenden Fotocollagen von Orten im Stammlager und Auschwitz-Birkenau. Ziel des Workshops war es, Auschwitz als Gedenkort zu begreifen Ein weiterer Workshop befasste sich mit biografischem Erinnern im Kontext des Nationalsozialismus. Nach der Erarbeitung verschiedener Gedenkformen, beschäftigten sich die Schüler*innen mit der Geschichte der jüdischen Familie Wahl aus Wuppertal und verfassten eine Gedenkrede. Im Rahmen des Workshops „Musik im KZ – Alltag oder Highlight?“ wurde die Bedeutung von Musik in Auschwitz anhand von zwei Opferbiografien beleuchtet. Ihre Lernerfahrung verarbeiteten die Teilnehmenden in einem selbstproduzierten Podcast. Im Workshop „78 Jahre danach. Auschwitz digital“ wurden die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau mithilfe von „Digital Storytelling“ erkundet und die Schüler*innen zu multimedialen Geschichtenerzähler*innen. Der Workshop „Auschwitz unfiltered“ widmete sich dem Konzept und den Funktionen historischer Authentizität in Gedenkstätten. Ihre Lernergebnisse präsentierten die Teilnehmenden in Form einer Augmented Reality-Ausstellung, die sie überall mithinnehmen können. Alle Ergebnisse wurden am letzten Tag der Exkursion gemeinsam vorgestellt und der gesamten Gruppe präsentiert.
Trotz oder gerade wegen des anspruchsvollen Exkursionsthemas, war es uns auch wichtig, die Rand- und Freizeitaktivitäten so angenehm und erholsam wie möglich zu gestalten. Die gemeinsamen Mahlzeiten in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte waren zum Beispiel ein schönes Ritual, durch das sich immer wieder unterschiedliche Tischkonstellationen und Austauschmöglichkeiten ergaben. An einem freien Nachmittag führte uns ein gemeinsamer Ausflug in das nahegelegene Krakau, das wir nach der historischen Führung durch das jüdische Viertel im Stadtteil Kazimierz auf eigene Faust touristisch und kulinarisch erkundeten.
Nach fünf ereignis- und lehrreichen Tagen und 14 Stunden Fahrt trafen wir am 24. August wieder in Wuppertal ein – müde, aber vor allem wehmütig, dass diese Exkursion doch so schnell vorbeigegangen war.
Das nehmen wir mit
Rückblickend lässt sich sagen, dass wir im Zuge der Exkursion vielfältige Lernerfahrungen sammeln konnten. Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Ort, die ein zentraler Bestandteil von jedem Workshop war, und der Einsatz vielfältiger Methoden ermöglichte es den teilnehmenden Schüler*innen das Gelernte und ihre Erfahrungen auf individuelle und kreative Weise auszudrücken. Als Lehrende sollten wir nicht nur unser Wissen zu anspruchsvollen Themen an die Schüler*innen weitergeben, sondern auch die Workshops anleiten, sodass individuelle Schwerpunkte gesetzt und Lernwege zusammen beschritten werden konnten. Für uns Studierende trug die Exkursion zur engeren Verknüpfung von Forschung und pädagogischer Praxis bei. Trotz des straffen Zeitplans und anhaltend hoher Temperaturen blicken wir mit Zufriedenheit auf eine Exkursion zurück, in der sich eine gesellige und vertrauensvolle Atmosphäre etablieren konnte, die es ermöglichte, tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln und unsere Erwartungen bei weitem übertrafen. Die Ergebnisse der Workshops konnten, mit Unterstützung der Studierenden, bereits am 2. September, dem Tag der offenen Tür des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums, präsentiert werden.
Romana Haupthof, Katharina Kröll, Dana Thiele

Im Rahmen der Vorlesung Digital History – Digitale Geisteswissenschaften im Sommersemester bot Prof. Patrick Sahle seinen Studierenden die Möglichkeit, drei Tage in die Spreemetropole zur diesjährigen Digital History Tagung zu reisen. Ein Zusammenhang war offenkundig, teilten sich beide Veranstaltungen doch denselben Titel. Grund genug für ein Dutzend Studierender, sich für die analoge Reise zu entscheiden. Die Restlichen versicherten, sich digital zuzuschalten. Um dieses Versprechen noch nachhaltiger zu gestalten, sollten sich alle einen Vortrag aus dem Programm aussuchen, den sich anschließend in den Sitzungen nach der Tagung im Plenum kurz vorstellen und kritisch beurteilen sollten. Die Online-Anmeldung für die Teilnahme nahm jede*r selbst vor. Für die Teilnehmer*innen vor Ort blieb nun die Frage nach Hin- und Rückfahrt, Unterkunft vor Ort und Finanzierung. Letztere konnte dank großzügiger Zuschüsse der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaft, der Fachschaft für Geschichte und dem Lehrstuhl für Digital Humanities der Bergischen Universität Wuppertal insoweit geklärt werden, dass letztlich allen Teilnehmer*innen – ausgenommen Verpflegung und ÖPNV in Berlin – die Exkursion komplett finanziert wurde. Für die Recherche nach möglichen Reiseoptionen und Unterkunft fanden sich zwei Teilnehmer*innen, die diese Aufgabe übernahmen. Man entschied sich für ein gemeinsames, anfangs komfortabel wirkendes Airbnb für alle, die nicht anderweitig schon genestet hatten, und das Reisen mit der Bahn; auf der Hinfahrt schnell im ICE, zurück gemächlich mit dem FlixTrain. Beide Male überfüllt – einmal auch tatsächlich pünktlich.
Ex abrupto startete dann die Digital History Tagung 2023 dank erwartbarer Zugverspätung. Dass durch die Anreise am Mittwochmittag zur Tagungseröffnung die seit dem Vortag stattfindenden Workshops, sowie die für den Vormittag angesetzte Studierendenkonferenz, leider nicht Teil der Exkursion waren, blieb als Benefit zum Start entsprechend Unbefangenheit. Eine Meinung würde so erst im Laufe des Tagungsprogramms gebildet werden. Dabei wäre die ein oder andere Veranstaltung hier sicherlich spannend gewesen. Andererseits wäre ein zusätzlicher Tag wohl auch mit mehr Aufwand verbunden gewesen.
Organisiert durch das Team der Professur für Digital History an der HU Berlin um Torsten Hiltmann, Melanie Althage, Martin Dröge und Claudia Prinz, stand als übergreifende Thematik der Tagung die Beschäftigung mit digitalen Methoden in den Geschichtswissenschaften und deren epistemologischen Konsequenzen im Vordergrund. Platz fand sich im Auditorium des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums in Berlin-Mitte. In 20-minütigen Vorträgen sollten Einblicke in konkrete Beispiele aus der Praxis gegeben werden, um in Konsequenz zu fragen, wie die digital-geschichtswissenschaftliche Arbeit Prozesse der historischen Wissensproduktion – und folglich auch das Fach Geschichte selbst – verändern kann. In einstündigen Blöcken mit eigener Rahmenhandlung gab es jeweils zwei Vorträge; die letzten 20 Minuten blieben für Fragen und Diskussion reserviert. Im Anschluss an jeden Block eine meist recht gestauchte Pause für Austausch und Kennenlernen. Für die nicht anwesenden Teilnehmer*innen der Tagung gab es die Möglichkeit, über Zoom die Veranstaltung nachzuverfolgen. Wirklich praktisch dagegen war, dass die Vorträge während der Übertragung auch aufgezeichnet wurden, und nun im Nachhinein über den hauseigenen YouTube-Kanal einsehbar sind. Ein Exkursionsbericht könnte so – natürlich rein hypothetisch -auf diese Videos dann im Text verlinken.
Nach obligatorischer Begrüßung und Einführung startete der erste Block unter der Rubrik Erfassung und Erschließung historischer Quellen. Den Anfang machten Roman Bleier und Florian Zeilinger der Universität Graz mit der Vorstellung des digitalen Editionsprojekts zur Erschließung der Regensburger Reichstagsakten von 1576 (YouTube: https://youtu.be/wfb8SubMN3U) Die Akten sind Resultat der Beratungen und Entscheidungen über die politischen Geschicke Mitteleuropas in den Monaten Juni bis Oktober 1576 durch Kaiser Maximilian II. und den Vertretern der Reichsstände in Regenburg. Ziel des Projekts ist es, das komplexe kommunikative Geschehen in Regensburg in seinem Facettenreichtum zugänglich zu machen. Besonderen Wert wurde dabei seitens der Referenten auf das verwendete Metadatenprinzip innerhalb der Edition gelegt, welche in Form von Archivalienbeschreibungen in der sogenannten Archivdokumentation gesammelt wurden. Da das Projekt insgesamt auf Bestände von 34 verschiedenen Archiven aufbaut, kommt der detaillierten Verzeichnung der Texte wie der systematischen Verzeichnung der zur Verfügung stehenden Metadaten eine hohe Bedeutung bei. Das so umfangreiche Quellenmaterial wird dadurch systematisch recherchierbar.
Im zweiten Vortrag stellte die nun an der Georg-August-Universität Göttingen promovierende Johanna Sophia Störiko die Ergebnisse ihrer Masterarbeit vor, die sich mit der digitalen Erfassung und Aufbereitung historischer Werbeanzeigen beschäftigte (YouTube: https://youtu.be/BSjZ6Kt1niE). Basis hierfür waren Scans der ersten fünf Jahrgänge der Kulturzeitschrift Die Jugend. Mit Hilfe eines eigens für das Vorhaben programmierten Tools segmentierte sie die Anzeigenseiten, um die einzelnen Anzeigen gesammelt in einer Datenbank zu speichern. Welche Unternehmen in den Anzeigen werben, wie die Produktkategorie, wurden manuell annotiert. Auch die Größe der Anzeigen und der strukturelle Aufbau wurden erfasst. Ergebnis ihrer Arbeit ist ein über 10.000 Anzeigen umfassender Datensatz inklusive einer daraus abgeleiteten Liste von 1345 Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum in der Zeitschrift geworben haben. So bieten sich Möglichkeiten, die Anzeigentätigkeit eines Unternehmens über die Jahre nachzuvollziehen, sowie Trends und Varianz in den Werbeanzeigen zu untersuchen. Interessant in beiden Vorträgen war vor allem die systematische Akribie innerhalb der Projekte, mit der die sehr umfangreichen Quellenkorpora erschlossen wurden. Das transparente und vielschichte Vorgehen, das in der Arbeit deutlich wurde, machte fast Lust, selbst einmal mit dem nun erschlossenen Material zu arbeiten.
Im zweiten Block zu Methoden und Autorschaftserschließung blickte Monica Berti von der Universität Leipzig zunächst auf antike fragmentarische Historiographie (YouTube: https://youtu.be/hijxUJ3QdR8). Ihr Projekt beschäftigt sich mit der Frage der Möglichkeit einer Analyse der Sprache erhaltener Quellen, welche auf verlorengegangene Schriften antiker Historiker referieren, um diese Fragmente zu sammeln und zitierbar zu machen. Verlorengegangenes soll so wieder rekonstruiert werden können. Dafür greift sie auf Techniken der Computerlinguistik zurück, um durch textbasierte Extraktion aus den verfügbaren Quellen antike griechische Referenzen auf Autoren und Werke zu annotieren und analysieren.
Till Grallert von der Humboldt-Universität zu Berlin stellte ein Projekt vor, welches sich auf stilometrische Analysen großer Textkorpora stützt. Auf Basis eines Datensatzes mit etwa 250 Artikeln, welche in sechs verschiedenen Periodika aus Bagdad, Beirut, Kairo und Damaskus zwischen 1892 und 1918 publiziert wurden, versuchte er Schlüsse über die anonyme Autorschaft zu ziehen (YouTube: https://youtu.be/d9WMwpO9SNU). Bei beiden Vorträgen überzeugte vor allem die Idee hinter den Projekten. Gerade das Projekt von Monica Berti hat selbst, da hier etwas an sich Verlorenes mit Hilfe digitaler Methodiken wieder verfügbar gemacht werden soll, fast schon etwas Magisches.
Unter dem Rahmenthema Methoden zu Inhaltserschließung startete der letzte Block des ersten Konferenztags. Felix Selgert und Alexander Ermakov von der Universität Bonn referierten in ihrem Arbeitsbericht über den Verwaltungsdiskurs in der preußischen Regionalverwaltung im frühen 19. Jahrhundert. Vor allem blieb ihr Vortrag aber ein methodisches Plädoyer für den Einsatz von Topic-Modellen in den Geschichtswissenschaften (YouTube: https://youtu.be/4K0U_gNnL5E) Ziel des Projekts ist ein Vergleich unterschiedlicher Modellarchitekturen mit der Frage, wie gut die logische Struktur der Quelle mit den einzelnen Modellen wiedergegeben werden kann. Dafür werden große Mengen an Text verschlagwortet – allerdings ohne zuvor inhaltliche Kategorien festgelegt zu haben – um im Anschluss nach dem Potential solcher Formen unbeaufsichtigten maschinellen Lernens für die digitalen Geschichtswissenschaften zu fragen. Zwar waren die vorgestellten Ergebnisse recht aufschlussreich, eine kritische Reflexion der zugrundeliegenden Prämisse – dass in traditionellen Topic Modellen noch viel Potential liegt – angesichts neuerer, leistungsstärkerer Technologien wie ChatGPT, wäre dennoch sicherlich sinnvoll gewesen. In Anbetracht des progressiven Untertons, den die Tagung als Ganzes für sich beanspruchen wollte, wirkte der Vortrag so fast etwas altmodisch.
Im zweiten Vortrag stellte Ina Serif von der Universität Basel das dort angesiedelte Projekt Printed Markets vor (YouTube: https://youtu.be/y3KEOFVEDkg). Hier wird mit eigens entwickelten dictionaries das Basler Avisblatt (1729-1844) digital aufbereitet und durch Taggen des Korpus die Anzeigen in einer Datenbank inhaltlich durchsuchbar.
Die Keynote zum Abschluss des ersten Tages hielt Hendrik Lehmann vom Tagesspiegel Innovation Lab (YouTube: https://youtu.be/q9FKpCXMfgQ) Neben einem kurzen Einblick in digitales journalistisches Arbeiten ging es vor allem um die Art der Vermittlung recherchierter Daten und deren Auswertungen mittels Visualisierungen; wie beispielsweise in interaktiven Karten, Graphen oder sogenanntes Scrollytelling. Auch wenn der Vortrag selbst mehr ein Durchklicken durch Projekte des Tagesspiegels blieb – was angesichts der fortgeschrittenen Zeit vermutlich das genau richtige Maß inhaltlicher Tiefe für den anwesenden akademischen Mittel- und Anbau war – hatte der Einblick in diese Form des Arbeitens doch etwas Anregendes, denn das Wissen um die digitale Aufbereitung und Vermittlung erarbeiteter Inhalte bleibt oft noch Achillesferse universitärer Arbeit. Der Vortrag endete mit einem Wink auf das Fehlen einer langfristigen Archivierung solcher Projekte digitaler journalistischer Arbeit, da die Redaktionen und Verlage aufgrund der ökonomischen Ausrichtung dafür oft nicht mehr die Prioritäten haben. So sind viele der meist aufwendigen Projekte schon nach wenigen Jahren digital nicht mehr verfügbar.
Der zweite Konferenztag begann unter der Rubrik Statistische Daten und ihre Auswertung mit einem Werkstattbericht seitens Werner Scheltjens von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Am Beispiel der dänischen Sundzolltabellen – einer Sammlung von Statistiken über Schifffahrt und Warenverkehr zwischen Nord- und Ostsee von 1497 bis 1783 – zeigte er die Chance einer emischen Perspektive auf die Genese historischer Datensammlungen durch digitale Werkzeuge und Methoden (YouTube: https://youtu.be/In3l3Y_rUqE). Da die Tabellen selbst digital verfügbar sind, sowie eine umfassende Historiographie des Projekts besteht, welches von Nina Ellinger Bang (1866-1928) initiiert wurde, wird es seiner Aussage nach möglich, in die Quelle einzutauchen und die Genese der Tabellen zu rekonstruieren. Sein Projekt nimmt in wissenschaftsgeschichtlicher Ausrichtung den Umgang mit historischen Daten in den Blick, um neue Erkenntnisse über vergangene historische Forschung zu gewinnen. Indem man die bereits bearbeitete Quelle nochmals aufbereitet, sollen Rückschlüsse auf die Art des Arbeitens der zurückliegend en historischen Forschung möglich werden. Für sein Verfahren prägte er den Neologismus der genetischen Datenkritik; ein leicht modifizierter Begriff, der auf die textgenetische Arbeit in der editionsphilologischen Praxis referiert.
Im zweiten Teil des Blocks untersuchte Frederike Schmidt von der Universität Greifswald in ihrem Vortrag europäische Aneignungspraktiken indigener Kulturgüter Australiens im 19. und 20. Jahrhundert unter Anwendung deskriptiver und deduktiver Statistik (YouTube: https://youtu.be/h99cE1PhNXk) Aus einer postkolonialen Perspektive werden anhand eines selbst erhobenen Datensatzes, welcher Informationen aus den 13 größten nationalen Sammlungen der EU-Mitgliedstaaten zu 4.862 indigenen Kulturgütern aggregiert, und anhand von 65 verschiedenen Variablen abbildet, in der Analyse strukturelle Muster bezüglich Aneignungspraktiken und Entwicklung von Museumssammlungen sowie der zentralen Protagonisten offenbart. Ihr Ziel, mehr Transparenz bei der Untersuchung solch sensibler historischer Ereignisse und deren Analyse zu schaffen, ist dabei sicherlich nachahmungswürdig.
Unter dem Thema Citizen Sciences und deren Daten begann der folgende Block mit dem Vortrag von Ian Kisil Marina vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte und dem Center of Digital Humanities-IFCH Unicamp in Brasilien (YouTube: https://youtu.be/oc6mUk3AL_M) Sein Vortrag behandelte den Einfluss von Crowdsourcing Methoden auf die Archivierung im digitalen Zeitalter. Basierend auf einer Studie zu digitalen Archiven über die Covid-19-Pandemie in Lateinamerika – mit Schwerpunkt auf Brasilien – konnte er zeigen, wie Crowdsourcing das Verständnis digitaler Geschichtswissenschaft geprägt hat, und wirbt für einen zukünftig kritischeren Zugang zu solchen Methoden.
Katrin Moeller und Georg Fertig von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eröffneten den zweiten Vortrag mit der Frage um Möglichkeiten von Citizen Science-Projekten für die Geschichtswissenschaften (YouTube: https://youtu.be/Jvdgh1ecdyY). Die Aufnahme von durch Laien erschlossenen, digitaler Massendaten in den Fachwissenschaften verbindet sich stets mit einer gewissen Skepsis. Für den exemplarische verwendeten Datensatz von 10,5 Mio. Adressbuchdaten, die von zahlreichen Freiwilligen des Vereins für Computergenealogie in den vergangenen Jahren zentral in einer Datenbank erfasst wurden, konnten die Referent*innen allerdings eine hohe Qualität crowdbasierter Daten feststellen. Zwar sahen beide einen hohen Bedarf an Kurationswerkzeugen, warben jedoch gleichzeitig für eine Intensivierung von Kooperationen zwischen Citizen Science und universitärer Forschung. Die Entwicklung einer geeigneten Datenkritik und methodisch passenden Grundlagen vorausgesetzt. Die Skepsis im Umgang mit solchen Daten konnten beide allerdings nicht nehmen.
Christian Wachter von der Universität Bielefeld eröffnete den nächsten Block mit dem Rahmenthema Right from the start: Daten und Methoden. In seinem recht jungen methodologisch ausgerichteten Projekt aus der Abteilung für Digital History und dem Center for Uncertainty Studies (CeUS) der Universität Bielefeld beschäftigt ihn die Auswertung von politischen Zeitungsdiskursen der Weimarer Republik und die Frage, welche Methoden sich für einen solchen heuristischen Ansatz eignen (YouTube: https://youtu.be/TrZ017g2cxY). Ziel ist eine flexible Auswertung des strukturierten Korpus mittels Visualisierung, Relektüren, Quellenkritik und -interpretation. Man darf gespannt sein, was dabei am Ende rauskommt.
Paul Ramisch von der Humboldt-Universität zu Berlin befasste sich im zweiten Vortrag mit digitaler Quellenkritik und stellte dafür die Ergebnisse seiner Masterthesis vor (YouTube: https://youtu.be/XIOo-AhwJuU) Am Beispiel des Open-Discourse-Korpus, einer strukturierten Sammlung der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages von 1949 bis 2021, erörterte er die Herausforderungen, die bei der Nutzung solch umfänglicher Korpora entstehen. Mittels einer Stichproben-Untersuchung konnte er zeigen, dass das untersuchte Korpus große strukturelle Schwächen aufwies und sich daher nur eingeschränkt für eine historische Forschung eignet. So wurden beispielsweise im mehrstufigen automatisierten Prozess bestimmte Reden nicht als solche verzeichnet, da Namen der Redner*innen nicht richtig erkannt wurden, wenn sie mit einem Adelsprädikat – und damit mit einem Kleinbuchstaben – beginnen. Abschließend setzte er sich für die Notwendigkeit einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Frage der Quellenkritik bei großen Quell-Datensätzen ein. Hier bedarf es neuer Modelle und Methoden, die jedoch nachvollziehbar und verständlich bleiben müssen.
Im Rahmen des Peter Haber Preis für Digitale Geschichtswissenschaft blieb der nächste einstündige Block einer Poster-Session vorbehalten. Die Tagungsgesellschaft wurde zur Abstimmung über das für sie gelungenste Poster aufgefordert. Die Poster mit den meisten Stimmen werden für eine Präsentation auf dem Historikertag 2023 in Leipzig vom 19.-22. September ausgewählt, die dort im Rahmen der Veranstaltung mit einem einminütigen Pitch kreativ vorgestellt werden. Die drei besten Vorstellungen werden prämiert. Wenn auch analog stoß das Format doch auf reges Interesse. Der mittlerweile durch das getaktete Veranstaltungsprogramm angestaute Redebedarf sorgte für einige interessante Gespräche. Der Ausflug ins Foyer endete nach gegenseitiger fachlicher Kenntnisnahme.
Unter dem Titel KI in den Geschichtswissenschaften I – Verfahren des maschinellen Lernens präsentierte sich der nächste Block. Michaela Vignoli vom Austrian Institute of Technology (AIT) sprach über den Einfluss von AI in der geschichtswissenschaftlichen Forschung und über einen damit möglichen Paradigmenwechsel in der Klassifikation historischer Bilder (YouTube: https://youtu.be/XRWYkjEltA8) Das von ihr vorgestellte interdisziplinäre Digital Humanities-Projekt ONit (Ottoman Nature in Travelogues) untersucht Naturdarstellungen in Reiseberichten über das Osmanische Reich, die zwischen 1501 und 1580 gedruckt wurden. Zugrunde liegt die Frage, welche Rollen diese Darstellungen in den Berichten einnahmen und wie dort das Verhältnis von Text und Bild gestaltet wird. Dafür wurde ein Workflow für das semi-automatisierte Auffinden und die Analyse dieser Texte und Bilder entwickelt. Durch maschinelles Lernen sollen die Beziehungen zwischen Texten, Bilder und Karten im Korpus analysiert und klassifiziert werden.
Anselm Küsters von der HU und dem Centrum für Europäische Politik in Berlin betrachtete in seinem Beitrag ein Korpus deutscher Reichstagsreden aus den Jahren 1867 bis 1932 für verschiedene Arten der Stimmungsanalysen zum Thema Telekommunikation (YouTube: https://youtu.be/a0qV1YeU_fo) Hierbei setzte er auf Wörterbuchmethoden, mit welchen sich derlei Stimmungen transparent messen lassen, machte aber auch auf Probleme dieser Ansätze aufmerksam. So können beispielsweise satirisch oder sarkastische Kommentare als solche nicht verstanden werden. Außerdem sind diese Modelle oft aus dem gegenwärtigen Sprachgebrauch abgeleitet und eignen sich so nur eingeschränkt für Reden früherer Epochen.
Konsequent folgte anschließend der zweite Teil zu KI in den Geschichtswissenschaften – Hybride KI und Semantic Web. Sofia Baroncini von der Universität in Bologna stellte einen ontologischen Ansatz in Semantic Web Technologien vor, welcher aus der Interpretationstheorie von Erwin Panofsky entwickelt wurde (YouTube: https://youtu.be/KuQ0yQ7ktTw). Inwieweit lassen sich also durch Semantic Web Technologien Interpretationen eines Kunstwerks auf verschiedenen ikonographischen Ebenen beschreiben? Hierzu wurde ein Linked Open Data Datensatz mit rund 400 verschiedenen Kunstwerken erarbeitet – größtenteils aus dem Mittelalter und der Renaissance. Philipp Schneider von der Humboldt. Universität zu Berlin beschäftigte in seinem Vortrag der Einsatz von Hybrid AI, um Bildquellen zu interpretieren (YouTube: https://youtu.be/ht9Kl1uc-xo) In seiner Fallstudie werden mittels Methoden maschinellen Lernens und symbolischer künstlicher Intelligenz Wappensammlungen aus mittelalterlichen Handschriften untersucht, um deren enthaltene kommunikative Ebenen und hierarchische Bedeutung zu analysieren. Wenn das Projekt auch noch erst am Anfang steckt, schien in jedem Fall schon Potential des Ansatzes erkennbar, um künftig große Mengen historischer Quellen besser für eine weitere Beschäftigung besser verfügbar zu machen.
Das anschließende Event am Ende des zweiten Konferenztages sollte auch gleichzeitig der Höhepunkt des Rahmenprogramms sein: Eine Bootsfahrt über die Spree. Und die muss bestimmt auch ganz schön gewesen sein – so hieß es zumindest. Denn auch wenn alle Eingeweihten in Richtung Flussufer flanierten, blieben die Studierenden zurück. Dass lag sicher nicht daran, dass a priori ein Charonspfennig zu leisten gewesen wäre. Eher vermittelte das Format selbst einen Eindruck von Geschlossenheit, und Erstteilnehmer*innen so auch das Gefühl, dort etwas deplatziert zu sein. Viel schöner wäre stattdessen gewesen, einfach vor Ort mit ein paar Häppchen und Getränken, ein geselliges Event zu planen. Das hätte vielleicht optisch nicht so viel geboten, hätte aber bestimmt dazu geführt, dass auch Nicht-Mitglieder des inneren Zirkels geblieben wären, um mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen. Dass der Bedarf für Gespräche da war, wurde spätestens in den Pausen zwischen den Vorträgen ersichtlich, in denen sich – obwohl die Organisation mehrmals dazu aufrief -niemand zeitig hinsetzen wollte.
Start des dritten und letzten Konferenztages – geografische Informationssysteme (GIS). Igor Sosa Mayor von der Universität Valladolid betrachtete in seinem Projekt die Mobilität katholischer Orden in der Frühen Neuzeit und deren Rolle in der europäischen globalen Expansion. Mit Hilfe von GIS-Methoden soll in einer Fallstudie exemplarisch untersucht werden, inwieweit der Erfolg missionarischer Arbeit dominikanischer Ordensmitglieder auf den Philippinischen Inseln mit deren enormen Mobilität zusammenhängt. Statt zuverlässiger Daten basierten jedoch große Teile der Arbeit auf einfachen Annahmen, die sich nicht wirklich durch das Vorhandene stützen ließen. Zudem war eine gewisse Anachronie der gesammelten Daten nicht zu leugnen. Viele Fragen blieben so nur unzureichend beantwortet oder mit dem Argument der dürftigen Datenlage schlicht abgetan. Inwiefern die Ausrichtung der Fallstudie als Ganzes zudem eine fast bestärkende Perspektive kolonialistischer Narrative einnahm, mag dahingestellt sein.
Mit historischen Geodaten und der Bedeutung von Mobilität beschäftigte sich auch der nächste Vortrag von Bart Holtermann, welcher sich der Erforschung der vormodernen ökonomischen Landschaft Nordeuropas widmete (YouTube: https://youtu.be/gm6IGxNtw6A) Ziel der vorgestellten frei zugänglichen Datenbank und Online-Karte Viabundus ist die Schaffung einer digitalen Infrastruktur für Forschung und Lehre. Systematisch werden Daten zum Fernhandel in Nordeuropa zwischen 1350 und 1650 zur Verfügung gestellt, die eine Analyse der Struktur der wirtschaftlichen Landschaft, sowie das komplexe Zusammenspiel von Jahr-, Stapelmärkten und Zollstellen diesbezüglich ermöglichen. Ein vielversprechendes Projekt, das beim Thema Visualisierung hoffentlich noch bis zur Fertigstellung das ein oder andere aus der Keynote des ersten Konferenztages umsetzt.
Der letzte Block der Tagung fand unter der Rubrik Reverse Engineering und Gamification statt. Von der Universität Bern kommend, stellte Daniel Gammenthaler eine Methodik des Reverse Engineerings von Artefakten digitaler Medien vor, um deren Materialität zu untersuchen (YouTube: https://youtu.be/Fl_qzaXxfiM) Zum einen als statische Analyse, in welcher solche mittels einer speziellen Software entschlüsselt und analysiert werden, andererseits dynamisch zur Betrachtung von Medienartefakten innerhalb einer Simulationsumgebung. Exemplarisch wendet er in seinem Projekt diese Methodik auf Schadsoftware an. Ansprechendes Ziel ist es, durch diese Art der Herangehensweise eine Art digitales Archiv für Schadsoftware zu entwickeln, die dabei aber noch funktionsfähig bleiben soll. Über Download-Optionen im Archiv wurden glücklicherweise keine Aussagen gemacht.
Zuletzt bewegte sich Malte Grünkorn in seinem Vortrag mehr im Bereich der Vermittlung von geschichtlichem Wissen im Digitalen. Das von ihm mitentwickelte Spiel #lastseen setzt sich das Ziel, in spielerischer Umgebung Fotos von NS-Deportationen lesen zu lernen. Zu lesen heißt in dem Fall nachzuvollziehen, wie mit diesen Bildern soziale Wirklichkeit konstruiert wird und die ihnen eingeschriebene Perspektive kritisch zu reflektieren. Anhand der Herangehensweise an eine solch sensible Thematik wurden Herausforderungen, aber auch Potentiale digitaler Spiele für pädagogische Umgebungen im Vortrag reflektiert. Das Spiel selbst ist bereits über die Website spielbar.
Zügig endete die Tagung für die Teilnehmer*innen der Exkursion wie sie begonnen hatte. Doch was bleibt außer der schwindenden Aura anwesender Ordinarienherrlichkeit und Restwärme der Fülle an Filterkaffee? Das offene und interessierte Klima der Tagung war in jedem Fall herauszuheben. Teils war es fast etwas schade, dass das Programm doch recht eng getaktet war, hätte man doch das ein oder andere kurze Gespräch gerne vertieft. Auch ein Einblick über Tendenzen, Fragen und Möglichkeiten im Fach selbst konnte man als studentische*r Teilnehmer*in eigentlich auch ganz gut bekommen. Ein bisschen mehr Raum für Geselligkeit hätte der Tagung dennoch sicher gutgetan. Die Vorträge waren an sich interessant, doch in der Ausgestaltung auch etwas monoton. Der Grund dafür wird in einer kritischen Nachfrage deutlich, welche in der Diskussion am Ende geäußert wurde – und die das Problem der Tagung sehr deutlich anpackt: Bei allen digitalen Methoden – wo bleibt die historische Fragestellung? Denn auch wenn die Vorträge wirklich mit einer beachtlichen Kompetenz im Digitalen überzeugten, blieb oft die Frage nach dem “Und nun?” offen. Das hätte dann auch die Vorträge etwas spannender gemacht. Eine klare Fragestellung zu Anfang, einen kurzen Überblick über die zugrundeliegenden digitalen Methoden, und dann Ergebnisse und bestenfalls eine erste Antwort auf die gestellte Frage. Digital ja, aber eben auch History. Eine Lücke, die dann hoffentlich die nächstjährige Tagung zu schließen weiß.
Von Johannes Ioannu

Am 20.06.2023 trafen sich elf Studierende aus dem Kurs „Geschichte inszenieren“ von Herrn Christian Günther am Alten Markt in der Kölner Altstadt für einen Besuch bei TimeRide Köln. Vor Ort wurden wir von einem Mitarbeiter in Schaffneruniform begrüßt, der uns in Kölschem Dialekt erklärte, wie der Besuch bei TimeRide aufgebaut ist. Dann wurden wir in ein Lichtspielhaus geführt. Dort bekamen wir eine Einführung über den historischen Rahmen des Rosenmontags 1926, der in der Inszenierung dargestellt wird. Durch den Ersten Weltkrieg und die britische Besetzung des Rheinlandes hatte es zuvor zwölf Jahre keine Karnevalsfeier gegeben. Für den Kölner unvorstellbar. Während des Films im Lichtspielhaus wurde Tessa Riedschneider vorgestellt, die in der Reihe vor uns saß und sich zu uns umdrehte, allerdings nur virtuell auf der Leinwand. Sie kam während der gesamten Inszenierung nur auf Video vor. Trotzdem interagierte sie mit den Schauspielern vor Ort. Nach der Filmvorführung, die in einem 2D-Format stattfand, wurden wir in den nächsten Raum geführt. Dieser war das Hutatelier von Tessa Riedschneider und mit Hüten und Kleidern im Stil der 1920er Jahre geschmückt. Dort huschte sie wieder über einen an der Wand angebrachten Bildschirm und war visuell präsent. Im Hutsalon bekamen wir einen Koffer mit dem von Tessa genähtem Prinzenkäppchen überreicht, das wir dem Karnevalsprinzen persönlich am Neuen Markt überreichen sollten. Daran anschließend nahmen wir in einem Straßenbahnwagen im Stil der 1920er Jahre Platz. Dort setzten wir eine VR-Brille sowie Kopfhörer auf. Nach einer kurzen Einführung zu technischen Einstellungen begann unsere Reise in der Straßenbahn vom Alten Markt bis hin zum Neuen Markt. Der Schaffner wurde ebenfalls von einem Schauspieler gespielt und gesprochen, war aber natürlich nur über VR zu sehen. Zu Bild und Ton kamen Bewegungen hinzu, sodass das authentische Gefühl gegeben war, eine historische Stadtrundfahrt in einer Straßenbahn zu unternehmen. Während der Fahrt sprach der Schaffner vorbeigehende Passanten an, sodass Themen, die die Menschen beschäftigten, aufgegriffen werden konnten. Ganz besonders eindrucksvoll war das Vorbeifahren an der Kölner Synagoge. Mit Rücksicht auf den heutigen Wissenstand war es ein beklemmendes Gefühl zu wissen, was ab den 1930er Jahren unter dem nationalsozialistischen Regime geschehen würde. Gegen Ende der Fahrt überreichten wir dem Kölner Karnevalsprinzen seinen Hut. Danach wandelte sich die Fahrt ins Abstrakte. Der Besucher stieg mit dem Straßenbahnwagon in den nächtlichen Himmel Kölns empor. Dabei vermittelte das per VR gezeigte Köln einen modernen Charakter. Damit endete die VR-Inszenierung und wir Studierenden wurden in die Realität Kölns im Jahr 2023 entlassen. Nach einer Mittagspause begrüßten uns die Entwickler von TimeRide Köln zu einem Gespräch, in dem wir Fragen stellen und unsere Eindrücke aus der Inszenierung teilen konnten. Die aktuelle Inszenierung, die den Rosenmontag 1926 in VR darstellt, ist bereits das zweite Projekt im Kontext der historischen Rundfahrt durch Köln. Die Entwickler gaben vor allem Informationen zu der technischen als auch historisch-orientierten Herangehensweise. Das per VR gezeigte Köln wurde detailgetreu nachgebaut. Dazu wurden alte Stadtpläne und Karten studiert. Die drei Entwickler berichteten, dass vor allem ältere Menschen die Inszenierung besuchen, um das „alte Köln“ nochmal zu erleben. Manche Besucher würden versuchen während der VR-Rundfahrt mitzufilmen, was dafürspricht, dass die Inszenierung zum einen authentisch ist und zum anderen die Menschen bewegt. Mit diesen Eindrücken im Gepäck wurden wir Studierenden in den sommerlichen Nachmittag in Köln entlassen. Auf der Heimreise in Richtung Wuppertal ließen wir unsere gesammelten Erfahrungen Revue passieren und tauschten uns aus. Für uns hatte die Inszenierung den Charakter einer Zeitreise, die ein authentisches Bild des historischen Kölns vermittelt. Vor allem die Emotionen der gezeigten Menschen waren greifbar nah. Im historischen Kontext war es allerdings ein beklemmendes Gefühl zu wissen, was in den 1930er Jahren passieren wird und dass das historische Köln nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört sein würde. Trotzdem überwogen in Bezug auf die VR-Erfahrung positive Eindrücke, die uns über die Exkursion hinaus beschäftigten. Der Besuch bei TimeRide ist empfehlenswert und bietet ein spannendes außeruniversitäres Lernangebot.
Elena Hilverkus


Brüssel als Hauptstadt Europas? Dieser Frage gingen vom 27.03. bis zum 30.03.2023 17 Studierende der Bergischen Universität unter Leitung von Dr. Bernd Bühlbäcker nach. Der Exkursion war eine gleichnamige Übung im Wintersemester 2022/23 vorausgegangen. Die Studierenden konnten frei nach eigenem Interesse ein Thema auswählen, anhand dessen sie sich der Geschichte Brüssels oder der Bedeutung der Stadt für Europa annäherten. Aus dieser Themenauswahl gingen Referate hervor, die vor Ort vorgetragen wurden und damit auch das Grundgerüst für das Exkursionsprogramm bildeten.
Die Gruppe startete am Montagnachmittag auf dem Grote Markt, wo das frühneuzeitliche Brüssel als Handelsmetropole sowie die burgundischen und habsburgischen Einflüsse auf die Stadt im Zentrum standen. Daran knüpfte sich Brüssel im „Goldenen Zeitalter“ an, wofür die Gruppe sich stadtauswärts auf den Weg zum Königlichen Palast machte. Am Abend ließ die Reisegruppe den Tag gemeinsam ausklingen und machte sich mit der belgischen Braukunst vertraut. Der Dienstagvormittag stand ganz im Zeichen des Flämisch-Wallonischen Konflikts sowie Autonomiebestrebungen innerhalb Belgiens, bevor die Studierenden sich mit Brüssel zur Zeit der Industrialisierung befassten. Am Nachmittag ging es vor den Toren Brüssels ins Afrika Museum Tervuren, wo sich die Gruppe mit der belgischen Kolonialgeschichte auseinandersetzte und vor allem der Frage nachging, wie Belgien heute mit diesem Erbe umgeht. Am Mittwoch wurde thematisch das 20. Jahrhundert eingeläutet, als es an den Denkmälern für die Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges um die doppelte Besatzungserfahrung Belgiens ging. Im Anschluss daran stand die Bedeutung Brüssels für Europa im Fokus, wobei ein Besuch im Haus der europäischen Geschichte nicht fehlen durfte. Trotz der besonderen Gestaltung des Museums, schloss sich an den Besuch eine kritische Diskussion über die Konzeption dessen an. Am Abend markierte die traditionell afrikanische Küche des Matongé-Viertels den kulinarischen Höhepunkt der Reise.
Den Abschluss und gleichzeitig das Highlight der Exkursion bildete ein Besuch im Europäischen Parlament, wo Tino Kunert einerseits von seinem Werdegang und Alltag als Mitarbeiter im Europaparlament erzählte, aber gleichzeitig auch die verschiedensten Fragen der Studierenden beantwortete und diskutierte, etwa über das Erasmus-Programm, den Brexit oder der Frage nach einer europäischen Identität. Einblicke in den reellen Alltag der politischen Arbeit des Parlaments konnten abschließend beim Besuch einer Plenarsitzung gewonnen werden, bei welcher der Bericht zur Rechtsstaatlichkeit der EU vergangenen Jahres reflektiert, sowie von verschiedenen politischen Akteur:innen evaluiert wurde. Hierbei wurde nicht nur das
individuelle Demokratieverständnis vertieft, sondern auch eine gewisse Ehrfurcht vor den vielfältigen politischen Mechanismen des modernen Europa erweckt.
Mit diesen Eindrücken im Gepäck ließ die Gruppe die Exkursion Revue passieren, bevor wieder die Heimreise anstand. Dabei wurde deutlich, dass die Exkursion nicht nur ein epochenübergreifendes Bild von Brüssel vermitteln konnte, sondern auch deutlich wurde, wie nah die Arbeit für Europa an unser aller Lebenswelt ist. Die multikulturelle und multiethnische Exkursionsgruppe konnte somit die (historische) Vielfalt Brüssels auf einem völlig neuen Niveau erfahren, die Wertschätzung für das europäische Projekt vertiefen und wertvolle geschichtskulturelle Anregungen erhalten.
Ann-Kristin Junker, Antoine Saint-Martin



BUW und TU-Berlin, 22.03.-25.03
Eine Gruppe von Studierenden der BUW und TU-Berlin machte sich im März auf, eindrucksvolle Beispiele der Industriekultur im Bergischen Land und Ruhrgebiet zu erkunden. Das Seminar kam in dieser ungewöhnlichen Form zustande, weil Frau Achermann von der BUW und Frau Weber von der TU-Berlin (früher ebenfalls BUW) sich entschlossen hatten, den Kurs gemeinsam durchzuführen. Die bergische Gewerberegion mit ihrer an den Wasserläufen gebundenen Textil- und Kleineisenindustrie und das Ruhrgebiet als Ballungsraum von Kohleabbau- und Eisenverhüttungs-Betriebe, boten sich für diese Exkursion daher perfekt an. Auf dem Plan standen neben Wuppertal auch Ratingen, Duisburg und Essen. Den Studierenden oblag es indes, die Exkursion aktiv mitzugestalten und sie durch ihre Vorträge zu bereichern.
Die Teilnehmer*innen kamen vor dem Engels-Haus in Wuppertal zum ersten Mal zusammen, nachdem sie sich in mehreren Online-Sitzungen kennengelernt und ausgetauscht hatten. Wuppertal musste jedoch zuallererst vom Alten Markt an der ehemaligen Bergbahn entlang bis zum Toelleturm erwandert werden (ob die Wuppertaler*innen im bergigen bergischen Gelände einen Geschwindigkeitsvorteil hatten, darüber ließe sich freilich streiten). Im Anschluss wartete der Direktor des Museums für Industriekultur Lars Bluma mit einem spannenden Vortrag über die bürgerliche Alltagskultur der Textilunternehmerfamilie Engels, die Bedeutung von jenem für die Geschichte des Sozialismus und die Arbeiterbewegung auf. Besonders bereichernd waren hier auch seine fachlichen Einblicke und die anschließenden Diskussionen über die Konzeption von Ausstellungen in Museen.
Am nächsten Tag ging es weiter nach Ratingen zur Textilfabrik Cromford, die eine große historische Bedeutung für die Frühindustrialisierung in Deutschland hatte. Hier konnten Nachbildungen des einst mächtigen hölzernen Wasserrades sowie von verschiedensten Maschinen und der Prozess der Textilverarbeitung bestaunt werden. Natürlich wurde auch der sozialhistorischen Komponente Rechnung getragen, indem die Ambivalenz zwischen den schlechten Arbeitsbedingungen auf der einen Seite und der Ausstellung des nahen Herrenhauses auf der anderen Seite herausgestellt wurde. Die Reise führte dann weiter zum Museum der deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg. Pünktlich zum anschließenden Rundgang durch den Duisburger Hafen, der von einem Vortrag über die Binnenschifffahrt begleitet wurde, schien auch die Sonne.
Der dritte Exkursionstag war der Geschichte der Schwerindustrie im Ruhrgebiet gewidmet und begann auf der Zeche Zollverein in Essen. Eine Führung durch die erhaltenen, zu einem “Denkmalpfad” ausgebauten Anlagen des Schachts XII bot uns die Chance, die Produktionsabläufe der Steinkohlenzeche nachzuvollziehen. Verbunden mit persönlichen Erfahrungen, Einblicken und lebendigen Anekdoten, vermittelte unser Guide wertvolle Einblicke in das Arbeitsleben auf der Zeche. Nach dem individuellen Besuch des Ruhr-Museums, ging es weiter zur Margarethenhöhe. Ende des 19. Jahrhunderts von dem Architekten und Stadtplaner Georg Metzendorf als Muster- und Gartenstadt erbaut, gilt sie heute als eine der schönsten und besterhaltenen historischen Wohnsiedlungen im Ruhrgebiet. Ein geplanter Abstecher zur Villa Hügel fiel dann leider sprichwörtlich ins Wasser.
Der letzte Tag der Exkursion begann im Bandwebermuseum in Wuppertal, wo die Geschichte der in der Region traditionsreichen Bandweberei gezeigt und einen Einblick in die Handwerkskunst gegeben wurde. Nicht lange danach war es an der Zeit, auf Wiedersehen (und keineswegs tschüss!) zu sagen. Mittlerweile hatte sich eine tolle Gruppendynamik eingestellt, bei der man oft nicht das Gefühl hatte, sich teilweise erst seit wenigen Tagen zu kennen. Maßgeblichen Anteil daran hatte wohl eine lebendige Abendgestaltung in den tollen Lokalitäten des Luisenviertels. Am Ende blieb der Eindruck, dass eine solche Exkursion nach einer Wiederholung ruft. Diesmal dann vielleicht auf der Berliner Seite.
Julian Heidinger (BUW)
Soyoung Sung (TUB)
Kathrin Tschida (TUB)

Seitens der Geschichts- und Erdkundedidaktik wurde im Wintersemester 2022/23 eine interdisziplinäre Seminarreihe unter dem Titel „Didaktische Zugänge zum Lernbereich Gesellschafswissenschaften“ angeboten und von Frau Christine Dzubiel sowie Herrn Dr. Stefan Padberg geleitet. Der Schwerpunkt dieses fachdidaktischen Kooperationsseminars war es, regionale Bahnhöfe als schulische Lernorte für den Geschichts- und Sachunterricht zu erforschen und zu entdecken. Dafür sollten die angehenden Grundschulund Sekundarstufenlehrkräfte, bestehend aus Bachelor- und Masterstudierenden unterschiedlicher Semester, gleichermaßen Methoden der schulischen Exkursionsgestaltung kennenlernen und im Zuge unternommener Besuche verschiedener Bahnhöfe selbstständig anwenden.
In der ersten Hälfte der Seminarreihe erhielten die Studierenden in mehrwöchig stattfindenden Seminaren einen umfassenden Einblick in die wissenschaftlichen Arbeitsweisen der unterschiedlichen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Hierzu zählten die Geschichtswissenschaft, die Sozialwissenschaft und die Geographie, die mit Blick auf die zu untersuchenden Faktoren „Raum“, „Zeit“ und „Gesellschaft“ genauer vertieft wurden. Anschließend waren die Studierenden dazu aufgefordert, sich in Gruppen zusammenzufinden und sich für einen regionalen Bahnhof ihrer Wahl zu entscheiden, der unter fachdidaktischen Kriterien der jeweiligen Disziplinen als Lernort vorbereitet werden sollte.
In der zweiten Hälfte der Seminarreihe standen schließlich die Besuche der entsprechenden Bahnhöfe auf dem Plan. Zu den Exkursionsorten zählten:
Zur jeweiligen Seminarzeit
Als Ganztagsexkursion:
Die jeweiligen Exkursionen waren so gestaltet, dass die Seminarteilnehmer das vorbereitete didaktische Material der Expertengruppen an den Bahnhöfen zur Bearbeitung erhielten und somit den jeweils angesteuerten Bahnhof unter unterschiedlichen Gesichtspunkten zielgerichtet entdecken konnten. Zentrale lerntheoretische Gesichtspunkte waren unter anderem die Baugeschichte, die innere und äußere Architektur der Empfangsgebäude, der gesellschaftliche Bedeutungswandel von Bahnhöfen, die sozialen Akteure innerhalb eines Bahnhofs, die infrastrukturelle Anbindung, die geographische Verortung des Bahnhofs sowie die öffentliche Wahrnehmung. Alle Bahnhöfe wurden mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen erreicht und lagen von Wuppertal aus gerechnet in einem Umkreis von 80km. Trotz vieler erfahrungsbedingter Vorbehalte gegenüber der Deutschen Bahn gestalteten sich die einzelnen Anreisen zur Überraschung aller Teilnehmenden gänzlich ohne Probleme und (fast) ohne gravierende Verspätungen.
Durch die motivierten Bemühungen der Studierenden, Bahnhöfe als Lernorte didaktisch vorund aufzubereiten wurde zum einen das Ziel erreicht, ein spannendes außeruniversitäres Lernangebot zu ermöglichen. Zum anderen erhielten die angehenden Lehrkräfte die Chance, praxisnahe Erfahrungen im Umgang mit selbstständig geplanten Exkursionen zu sammeln. Für das neue Semester darf der Wunsch ausgesprochen werden, dass ein solches Kooperationsseminar wieder stattfinden wird.
Stefan Jennessen
Melis Memedoska
Panagiota-Irina Sergini



Am Freitag, den 27. Januar 2023, ging es trotz stürmischen Wetters und eisigen Temperaturen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung „Die Altenberger Fundatio – Gründungsgeschichte, Mythos, Vita“ in die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Seit dem angenehm geheizten Foyer den geschulten Händen von Frau Bibliothekarin Dr. Ute Olliges-Wieczorek anvertraut lernten wir, dass auch mittelalterliche Codizes es nicht unbedingt warm haben – Sie lagern in einem Tresor bei etwa 18 Grad.
Nach einer kurzen Einführung durften die Studierenden sich in Kleingruppen zu dritt je mit einem mittelalterlichen Codex befassen, deren Entstehungszeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert reichte. Nur wer die Hände gewaschen hatte, durfte die fast seidenen Pergamente umblättern, wobei Restauratorin Anika Ringelkamp darum bat, die prächtigen Illuminationen nicht zu berühren. Ein erstes Highlight war hier die Betrachtung der das ganze Semester über besprochenen Fundatio, der Gründungsgeschichte des Klosters Altenberg, in der Handschrift MS B-117. Unscheinbar wirken die schmalen Buchstaben auf braun verfärbten Seiten, als frühste Überlieferung aber hat die Fundatio hohen Wert für die regionale Landesgeschichte.
Erstaunen griff um sich, dass Menschen einmal in mühseliger Arbeit diese Kunstwerke mit den eigenen Händen geschaffen hatten. Nur 30 Minuten Zeit waren für den Gruppenarbeitsschritt eingeplant, doch gestaltete sich die Betrachtung und Untersuchung der Codizes so spannend, dass wir erst nach weiteren 20 Minuten zur Vorstellung der Handschriften schreiten konnten. Die Studierenden hielten sich nicht mit Fragen zurück und Frau Dr. Olliges-Wieczorek sowie Frau Ringelkamp gaben gern fachlich versierte Auskunft.
Im Anschluss berichtete Frau Ringelkamp von den Freuden und Mühen im Beruf der Restauratorin, wie mittelalterliches Pergament herzustellen sei, welch zahlreiche Arbeitsschritte es brauchte, bis die Schrift auf die dünnen Blätter geschrieben werden konnte und demonstrierte, woher eigentlich der Ausdruck „ein Buch aufschlagen“ kommt.
Den krönenden Abschluss bildete die Betrachtung der Handschrift MS D-7, ein Antiphonale, das neben den über und über mit Neumen beschriebenen, 40 cm hohen Seiten durch seine golden leuchtenden Illuminationen, beispielsweise vom Tod Jesu Christi, aufwartet. Trotz des langen Aufenthalts ohne Pause und Getränke hielt die Begeisterung bis zum Schluss an – ein schöner Abschluss für das Semester!
(Vera Eiteneuer)

24. November bis 27. November 2022 in Leipzig
Am 24.11.2022 machten sich 10 Studierende aus Wuppertal auf den Weg nach Leipzig. Dort beschäftigten wir uns in einem dreitägigen Workshop mit historischem Lernen über die sogenannte „Wendezeit“ mittels Musik. Da an dem Workshop aber auch 10 Studierende aus Leipzig teilnahmen, ging es auch um einen Austausch west- und ostdeutscher Perspektiven. Hierbei fiel uns auf, dass die „Mauer in den Köpfen“ auch bei der jüngeren Generation noch zu bestehen scheint.
Am Freitag nahmen wir an einem Stadtrundgang zur „Friedlichen Revolution“ mit einer Zeitzeugin teil. Dies wurde als Anlass genommen über die verschiedenen Geschichtsbilder der Ereignisse von 1989/90 zu diskutieren.
Der Samstag (26.11.) stand ganz im Fokus der „Baseballschlägerjahre“, also die Reihe von rechtsextremen und rassistischen Anschlägen unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Hierbei evaluierten wir ein Lernmodul der Website „89 rockt!. Geschichte hören und verstehen“, bei welchem sich dem Thema über drei verschiedene Lieder genähert wurde. Die Website von Dr. Anna Lux (Freiburg) und Prof. Dr. Juliane Brauer wird im nächsten Jahr online gehen und verschiedene Lernmodule zu Themen der „Wendezeit“ beinhalten. Bei allen Modulen wird der Zugang mit Hilfe von populärer Musik geschaffen (z.B. 9010 von Kummer).
Am Sonntag (27.11.) ging es dann darum sich selbst kreative Produkte zur Vermittlung von den Themen des Workshops zu überlegen, bevor es wieder zurück nach Wuppertal ging.
Der Workshop ist Teil eines von der Bundeszentrale für Politische Bildung finanzierten Projektes zum historisch-politischen Lernen in und über die sogenannte „Transformationszeit“, die Jahrzehnte seit 1989/90. Am 23. Februar wird in diesem Rahmen in der Citykirche Elberfeld eine Abendveranstaltung stattfinden, bei welcher die kreativen Ergebnisse des Workshops präsentiert werden und die Website veröffentlicht wird. Zudem wird Hendrik Bolz (Autor des Buches „Nullerjahre“ & Rapperduo „Zugezogen Maskulin“) mit uns über die „Wendezeit“ sprechen.

Die Exkursionsteilnehmer*innen vor dem Hochofen 5 im Landschaftspark Duisburg-Nord

Exkursionsteilnehmer*innen gehen auf das große Haus der Villa Hügel zu

Jahrhunderthalle
Seitens der „Geschichte und ihrer Didaktik“ wurde im Sommersemester 2022 eine viertätige Übung zur Geschichts- und Industriekultur unter der Leitung von Herrn Dr. Bernd Bühlbäcker in Form einer Exkursion mit dem Fahrrad vom 26. bis 29. Septembers 2022 angeboten. Schwerpunkt dieser Exkursion mit dem Titel: „Kathedralen der Industriekultur?!“ war die Entdeckung sowie die Erforschung industrie- und geschichtskultureller (Erinnerungs-)Orte im Ruhrgebiet. Die Exkursion war so gestaltet, dass zunächst in einer Blockveranstaltung zentrale Konzepte der Geschichts- und Industriekultur vorgestellt, analysiert und reflektiert wurden. Die Studierenden erarbeiteten selbständig in Gruppenarbeit einzelne Schwerpunktthemen und fungierten an den einzelnen Stationen der Exkursion als Experten. Hierbei führte die Route über alte Bahntrassen, Feldwege und Treidelpfade in unterschiedliche Stadtteilen in Essen, Oberhausen, Duisburg und Bochum und jeden Abend diente eine andere Jugendherberge als Unterkunft. Die durchschnittliche Etappenläge eines Tages lag somit bei circa 50km.
Bereits zu Beginn der Tour stellte der Wettergott die Gruppe vor die erste Herausforderung. Bei dunklem, wolkenbehangenen und sehr regenreichem Wetter trafen sich alle Teilnehmer montagmorgens um 10 Uhr an der Zeche Zollverein. Regenfest von Kopf bis Fuß und hochmotiviert startete die Exkursionsgruppe ihre Entdeckungstour auf dem Gelände der Zeche und Kokerei Zollverein. Nach einem Halt an der Arbeitersiedlung Hegemannshof führte die Reise über den Emscherradweg weiter bis nach Oberhausen. Dort stand nach einer mehr-stündigen nassen Tour eine Besichtigung des Gasometers auf dem Programm. Um den weiterhin von oben kommenden Wassermengen dieses verregneten Septembertages kurzzeitig zu entfliehen, lud das angrenzende Einkaufszentrum Centro Oberhausen zu einer wärmespenden Rast und Einkehr ein. Gut genährt und aufgewärmt ging die Reise durch den nicht aufhörenden Regen weiter entlang der Emscher und dem Rhein-Herne-Kanal, über die Duisburger Hafenanlagen bis zum Gelände des Landschaftsparks in Duisburg-Meiderich, wo die dortige Jugendherberge als Nachquartier diente. Mit Hilfe einer Fotorally erkundete die Gruppe das Gelände des Landschaftsparks bei einer Nachwanderung und ließ sich von den zahlreichen Lichtinstallationen begeistern.
Der zweite Tag der Tour bot zur Erleichterung aller Teilnehmer keinen allzu reichen Regenguss, sodass man sich nach einem ausgiebigen Frühstück beschwingt auf sein Fahrrad setzen konnte. Die Route führte über den Duisburger Binnenhafen als Beispiel für die Ambivalenz des Strukturwandels, entlang der Ruhr in Richtung Essen-Mülheim, um dort die Villen ehemaliger Großunternehmer zu entdecken. Höhe-punkt des Tages war die über den Ufern des Baldeneysees thronende Villa Hügel der Unternehmerfamilie Krupp, deren Parkanlage mit den Rädern erkundet wurde und anschließend von innen besichtigt wurde. Nicht unweit der Villa endete der Tag kurz vor Einbruch der Dunkelheit in einer Jugendherberge in Essen-Werden, die sich zur Überraschung aller durch ihre unerwartete Höhenlage kennzeichnete, sodass der Abschluss dieses Tages mit der körperertüchtigen Erkenntnis endete: „Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt!“ Der Abend wurde mit nicht wenigen hopfenhaltigen Brauerzeugnissen der Region gekrönt.
Nachdem alle Muskeln wieder entspannt und kleine Blessuren auskuriert waren, machte sich die Gruppe bei einer nur leichten Wolkendecke morgens auf die letzte große Etappe des Tages, die entlang des herbstlich bunten Baldeneysees über zahlreiche Brücken bis nach Hattingen und Bochum führte, wo die Geländeerkundung der Jahrhunderthalle auf dem Programm stand. Wiederum standen Fragen der Geschichts- und Industriekultur im Zentrum der Diskussion. Bei fast strahlendem Sonnenschein endete diese insgesamt recht kurz gehaltene Schlussetappe zur Freude aller in einem Hotel. Im nahe gelegenen „Bermuda-Dreieck“ klang der Abend nach einem gemeinsamen Essen feuchtfröhlich aus.
Der vierte und letzte Tag endete mit einer vom Dozenten Dr. Bernd Bühlbäcker angeleiteten Fachdiskussion über die Bedeutung und Ambivalenzen der Industrie- und Geschichtskultur für das Ruhrgebiet. Zur Freude aller zeichnete die Exkursionsgruppe durch viel fachliches Interesse, großem Engagement sowie einen bemerkenswerten Zusammenhalt und eine unentbehrliche Motivation aus, sodass keine Hürde zu groß war, um sie nicht gemeinsam bewältigen zu können. Eine unvergessliche Exkursion!
Bericht: Jule Brückelmann und Stefan Jennessen

Prof. Dr. Juliane Brauer und Christine Dzubiel
Im Rahmen der Didaktik-Übung „Geschichtskultur in Nürnberg“ besuchten im Zeitraum vom 11.09 bis zum 13.09.2022 eine Gruppe von zwölf Studierenden die Stadt Nürnberg unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Juliane Brauer und Frau Christine Dzubiel.
Ziel der Exkursion war es, in Gruppen ausgewählte historische Orte der Stadt auszusuchen und für die Teilnehmer:innen als Lernorte zu erschließen. Somit hatten alle Studierende nicht nur die Möglichkeit gehabt, in dem Zeitraum eine Fülle an historisch relevanten Stätten zu besuchen, sondern sie wurden auch mit einer großen Anzahl an Möglichkeiten vertraut gemacht, wie man im späteren Berufsfeld als Lehrer:in eine Klasse bei einer Exkursion begleiten kann und mit welchen Methoden man dann zusammen geschichtskulturelle Phänomene erschließen kann.
Es wurden dabei Orte aus der Epoche des Mittelalters sowie der Neusten Geschichte besucht, da zu beiden Epochen ein besonderer Bezug in Nürnberg gezogen wird. Somit befanden sich an einem Tag die Studierenden mitten im Trubel eines “mittelalterlichen” Marktes zwischen verkleideten Hofdamen und Rittern, und am nächsten Tag wurde das Memorium der Nürnberger Prozesse besucht und man bekam durch Ton- und Filmaufnahmen sowie den Anblick des Schwurgerichts selbst einen Einblick in eine der wichtigsten Gerichtsverhandlungen der ganzen Menschheitsgeschichte. Auch wichtig zu erwähnen ist die Arbeit auf dem Reichsparteitagsgelände. Die Größe des Geländes sowie des Monuments und des unvollständigen Baus des Kongressgebäudes hatte auf alle Studierende eine nachhaltige Wirkung, die wir dann gemeinsam dekonstruierten.
Eine interessante und schöne Entwicklung, die die Gruppe der Studierenden untereinander durchmachte, war unter anderem, dass es anfänglich von einem schüchternen Miteinander zu tiefgründigen Diskussionen und einem ständigen Austausch von Fragen zu der Thematik miteinander gab. Natürlich wäre es viel vorbildlicher diesen wissensbegierigen Austausch konsistent anzuhalten, dennoch kam es zu einer schönen Abschlussrunde in der traditionellen fränkischen Küche von der „Albrecht-Dürer-Stube“ in der man die Erlebnisse der Exkursion ausklingen ließ.
Vanessa Czernik

Auf den Spuren von Heinrich und Thomas Mann begaben sich Germanistik- und Geschichtsstudenten der Bergischen Universität mit Herrn Prof. Dr. Meier und Herrn PD Dr. Karsten nach Lübeck. Die Exkursion fand am letzten Septemberwochenende 2022 statt und begann am Freitagnachmittag. Gespannt lauschten die zwölf Wissbegierigen einer Führung durch die mittelalterliche Kirche St. Marien. Das Kirchengebäude beeindruckte vor allem dadurch, dass es sich um das höchste Backsteingewölbe der Welt handelt und die Baugeschichte an vielen verschiedenen Stellen nachvollzogen werden kann. Bei dem geschichtsträchtigen Glockenspiel konnten die Studenten mit Gummihämmern ihr eigenes musikalisches Können an den verschieden klingenden Glocken unter Beweis stellen. Einen besonderen Höhepunkt stellte die Aussicht über Lübeck bei Nacht dar, die den circa 400 Stufen langen Aufstieg in einen der Türme St. Mariens belohnte.
Am folgenden Tag besichtigte die Gruppe unzählige Schauplätze der „Buddenbrooks“, den Dom und das St. Annen Museum mit der darin gezeigten Ausstellung zu Heinrich Manns Erfolgsroman„Der Untertan“. Die Wuppertaler haben sich gefreut mit der Ausstellung die Arbeit einer ehemaligen Kommilitonin zu betrachten, die dort als Kuratorin tätig ist. Bei einer geführten Besichtigung der Altstadt tauchte die Truppe in das Lübeck des 19. Jahrhunderts ein. Neben dem leider wegen Renovierungsarbeiten zur Zeit geschlossenen Buddenbrookhaus in der Mengstraße sahen und hörten die Studenten viel vom Leben und Wirken der Brüder Thomas und Heinrich Mann. Wie auf Exkursionen üblich kam der fächer- und disziplinenübergreifende Austausch während der verschiedenen Programmpunkte auch bei den kulinarischen und gemütlichen Teilen nicht zu kurz. Ein Besuch im Café Niederegger, in dem Lübecker Marzipan in Kuchenform vor Ort und als Andenken erworben werden konnte, durfte natürlich nicht fehlen.
Am Sonntag taten die Studenten es Tony, Morten und Hanno gleich, indem Sie einen Ausflug vor die Tore der Stadt nach Travemünde unternahmen. Gestärkt von einem Naturspaziergang ging es zurück in die Stadt und bei einem leckeren Schollenfilet in der traditionsreichen Schiffergesellschaft fand die Exkursion einen gelungenen Abschluss.
Clemens Borghorst und Pauline Rützenhoff

Vom 8. bis 13. März 2022 wandelte eine Gruppe Wuppertaler Studentinnen und Studenten unter der Leitung von PD Dr. Arne Karsten durch die Ewige Stadt auf den Spuren deutscher Romreisender. Nach den ruhmreichen Gesandtschaften der Jahre 2017 und 2019 handelte es sich hierbei um die nunmehr dritte Delegation, welche die Bergische Universität an den Heiligen Stuhl entsandte. Während eine päpstliche Audienz weiterhin auf sich warten lässt, brachten die Studierenden dafür die Steine von Sankt Peter umso vernehmlicher zum Sprechen.
So begann denn sowohl der erste wie auch der zweite Exkursionstag mit einem Besuch der Petersbasilika, bei dem sich die Truppe darum bemühte, zahlreiche Grabmäler, Gemälde und Skulpturen als Quellen fruchtbar zu machen. Besondere Schwerpunkte bildeten die Diskussionen um die frühneuzeitliche Papstfamilie Barberini sowie die berühmte Schweizer Garde und die Ex-Königin Konvertitin Christina von Schweden (1626-1698); Themen, die gleichsam den Aufhänger für die Beschäftigung mit den ersten beiden Protagonisten der Exkursion boten. Sowohl Matthäus Schiner (1465-1522), Schöpfer der bis heute bestehenden Schweizer Garde, als auch Lukas Holsten (1586-1661), Hamburger Universalgelehrter, Bibliothekar und Konversionsexperte im Dienste der Barberini, erhielten Grabinschriften in der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima, deren Besuch neben anderen Objekten wie dem Palazzo Barberini und dem Campo Santo Teutonico an den ersten beiden Tagen auf dem Programm standen.
Vom intellektuellen Feuereifer des dritten Protagonisten beflügelt, nahm die Gruppe außerdem das architektonische Ensemble der Piazza Navona sowie die Jesuitenkirchen Sant’Ignazio di Loyola und Il Gesù in Augenschein. Über die Beschäftigung mit Athanasius Kircher (1602-1680), dem deutschen Tüftler, Sprachwissenschaftler und Wunderkammerkurator, geriet so die Societas Jesu als gegenreformatorischer Bildungsorden am dritten Tag ins Blickfeld. Zu guter Letzt wandte die Truppe ihre Aufmerksamkeit von der barocken Sinnlichkeit der Vormoderne hin zum kühlen Bürokratismus der italienischen Staatsgründung. Mit Ferdinand Gregorovius (1821-1891), zeitgenössischem Beobachter des Risorgimento und intimem Kenner des päpstlichen Roms, vollzogen die Studierenden den Wandel der Tiberstadt vom idyllisch-überwucherten Papstsitz zur rastlosen Hauptstadt des Königreichs Italien nach. Den in der nationalstaatlichen Bauwut untergegangenen Zauber des alten Roms atmeten die Studierenden zwar noch einmal in der marmorgesättigten Pracht der Kunstwerke Gianlorenzo Berninis und der Villa Borghese, doch die grobschlächtige Monumentalität der Moderne holte sie alsbald auf der Piazza Cavour und der Piazza Venezia ein, wo die bisher so verwöhnten Augen nicht umhinkamen, mit dem Palazzo di Giustizia und dem „Monumento Nazionale“ konfrontiert zu werden.
Die Sinne berührte indes nicht nur Bilderglanz und Marmorpracht, sondern auch der Genuss der drei Heiligen der römischen Küche: Trippa, Puntarelle, Coda alla vaccinara – nebst kunstfertig veredelter Weintrauben aus dem nahen Umland. Kurz: eine vielseitige Exkursion, die der 50-jährigen Chronik der Bergischen Universität eine kunstvoll illuminierte Seite hinzufügt.
Jonathan Huppertz und Michael Schwedt

Vom 29.02.-06.03.2020 fand unter der Leitung von PD Dr. Juliane Brauer, Dr. Bernd Bühlbäcker und Christine Dzubiel eine Exkursion nach Israel statt. Der Exkursion war im Wintersemester 2019/20 ein vorbereitendes Seminar mit dem Titel “Israelische Geschichts- und Erinnerungskultur im Wandel” vorausgegangen. Möglich wurde die Exkursion durch das Preisgeld, das an die Verleihung des großen „Lehrlöwen“ 2018 an Frau PD Dr. Juliane Brauer gebunden war und Dank der großzügigen Unterstützung durch das Richard Koebner Minerva Center der Hebrew University, Jerusalem. 15 Studierende konnten gemeinsam mit ihren Dozierenden nach Akko, Jersualem und Tel Aviv reisen und dort verschiedene, für die israelische Erinnerungskultur zentrale, Orte besuchen, wie beispielsweise das Ghetto Fighter House oder die nationale Gedenkstätte an die Shoah, Yad Vashem.
Hochqualifizierte Guides, die auf unseren Themenkomplex der Erinnerungskultur zugeschnittene Führungen anboten, machten die Besuche zu einem deutlichen Mehrwert für den Lernerfolg der Gruppe. Dies wurde besonders in den allabendlichen, ausführlichen Reflexionsrunden deutlich. In diesen tauschten sich die Studierenden unter Anleitung der Dozierenden und ab und an auch der Studierenden selbst, über das Erlebte aus und konnten offen gebliebene Fragen stellen und diskutieren.
Davon abgesehen wurde im Zuge der Exkursion auch der Austausch zwischen israelischen und deutschen Studierenden im Rahmen eines gemeinsam an der Hebrew University in Jerusalem verbrachten Tages ermöglicht. Dieses Zusammentreffen war ein besonders wichtiger Baustein der Exkursion. Durch eine kurze Vorstellungsrunde wurde eine erste Vertrauensbasis geschaffen, welche bei anschließender Arbeit in Kleingruppen vertieft wurde. Damit wurde ein Raum des Austausches und der Diskussion ermöglicht, in dem über Fragen der israelischen Erinnerungs- und Geschichtskultur, aber auch des alltäglichen Lebens geredet werden konnte. Hierbei wurden für uns insbesondere die unterschiedlichen Konfliktlinien innerhalb der israelischen Gesellschaft durch verschiedene Bevölkerungsgruppen deutlich verständlicher.Der große Erfolg der Exkursion war in besonderem Maße der ausgezeichneten, sich über ein Jahr hinziehenden, Organisation durch die Dozierenden sowie vieler Unterstützer vor Ort geschuldet. (Man munkelt, sogar das ununterbrochen schöne Wetter sei eigens bestellt worden.) Aber auch die gute Dynamik innerhalb der Gruppe sowie die durchweg hohe Motivation aller Beteiligten, machten die Woche in Israel so besonders lehrreich.
Der Aufenthalt in Israel gab einen aufschlussreichen Einblick in die israelische Gesellschaft und in die Lebenswirklichkeiten vor Ort, wie er niemals durch ein reguläres Seminar hätte vermittelt werden können. Am Ende der Exkursion flog die Gruppe nach Wuppertal zurück, mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck und einem klaren Wunsch: möglichst bald nach Israel zurückzukehren.

Den „Vitalienbrüdern“ auf der Spur…
Am Freitag dem 24.01.2020 machte sich eine Gruppe von 14 Studierenden der Germanistik und Geschichte um PD Dr. Karsten auf große Fahrt gen Lübeck. Drei Tage lang bestand die Möglichkeit, die Hansestadt an der Trave zu erkunden. Die intensive Betrachtung und Begehung zahlreicher Sehenswürdigkeiten, wozu auch die Stadt als solche gezählt werden kann, versetzte die Studierende in eine kleine Zeitreise. Das Mittelalter begegnete ihnen in Form der altehrwürdigen Kirche St. Marien. Zunächst vom Boden betrachtet, machte das höchste backsteingemauerte Gewölbe der Welt, mit welchem die Kathedrale aufwarten kann, mächtig Eindruck. Doch die anschließende Begehung der 125m hohen Türme, zu denen rund 400 Stufen hinauf und wieder hinab zu bewältigen waren, der Blick über die Altstadt Lübecks und das Lauschen des kleinen Geläuts der gotischen Basilika gehörten wohl zu den memorabelsten Momenten dieser Exkursion. Weiter durch die Geschichte der Stadt reisend, besuchten die Studierenden das fast 800 Jahre alte Rathaus. Im Rahmen einer Führung bestand die Möglichkeit historisch und auch tagesaktuell bedeutende Räumlichkeiten wie den Senats- und Gerichtssaal, den Tagungsort der Bürgerschaft sowie den Versammlungsraum der Hanse unter den wachsamen Augen der Ahnen der Stadt zu durchschreiten und Fragen zu stellen. Die Zeitgeschichte begegnete den Studierenden im Willy-Brandt-Haus, in dem das Leben und die Taten des berühmten Sohnes der Stadt anschaulich aufbereitet waren. Für das leibliche Wohl wurde in Traditionshäusern wie der Schiffergesellschaft oder auch dem Café Niederegger gesorgt, wo mancher seiner Schwäche für die Süßigkeit erlag, die es an dieser Stelle schon seit dem frühen 19. Jahrhundert zu naschen gibt. Beim Spazieren durch die Gassen war die Geschichte der Hansestadt stets präsent. Das Stadtleben, widergespiegelt in Bauweise und Stadtstruktur, der Handel und Lübeck generell als wichtiger Warenumschlagplatz schon seit der Frühen Neuzeit - ein Bild, das aufgrund vorangegangener Lektüre und Beschäftigung zunehmend Form in den Köpfen der Studierenden annehmen konnte. Hierzu führte auch der ausgewiesene Höhepunkt der Exkursion am Sonntag. Ein Besuch im deutschen Hansemuseum, in dessen Sonderausstellung „Störtebeker und Konsorten“ das Wissen um den Mythos Störtebeker, die historische Bewandtnis der Vitalienbrüder und das Spannungsfeld zwischen gesetzlich geregelter Kaperfahrt und Piraterie vertieft und beleuchtet werden konnte. Mit diesen Eindrücken im Gepäck ging es am späten Sonntagnachmittag begleitet durch angeregte Gespräche und Diskussionen zurück in Richtung Heimat.

Mozart, Beethoven, Maria-Theresia und Falco. Auf die Spuren dieser und weiterer Wiener Legenden hatten sich vom 1. bis 5. Oktober 2019 die Studierenden der Universität Wuppertal begeben, die unter der Anleitung von Herrn Dr. Bernd Bühlbäcker und Frau Christine Dzubiel die Hauptstadt der charmanten Alpenrepublik Österreich besuchten, erkundeten und sich erschlossen.
In einem Seminar zur Geschichtsdidaktik und -kultur waren zuvor schon Themen abgesteckt worden, anhand derer die Studierenden ihren Kommilitonen und den Lehrenden jeweils einen bestimmten Aspekt der Stadt zeigen sollten. So kam es, dass nicht nur das klassische Sightseeing Programm, sprich die Hofburg und der Heldenplatz und dazu das klassisch kaiserliche Wien den Schwerpunkt der Exkursion bildeten, sondern ein breites Panorama einer Stadt, die schon mehr als zwei Jahrtausende auf dem Buckel hat. So besprach man nicht nur anhand des monumentalen Maria-Theresien Denkmals und des — etwas weniger monumentalen, doch aus historischer Sicht trotzdem wichtigen — Austria Brunnens das habsburgische Wien und ging den Spuren der Kaffeehauskultur nach, die danach bis auf den Kahlenberg führen sollten, sondern stattete auch dem Jüdischen Museum in Wien einen Besuch ab und schritt danach, von kompetenten Studierenden angeleitet, die wichtigsten Stationen des jüdischen Lebens der vergangenen Jahrhunderte in Wien ab. Über die Leopoldstadt ging es so zur Synagoge der Stadt, deren Bauweise — direkt zwischen anderen Wohngebäuden stehend — 1938 verhindert hatte, dass sie in Flammen aufging, zurück zum Judenplatz, an dem das wieder errichtete Denkmal Lessings den Abschluss der Führung durch das „jüdische Wien“ bildete.
Neben dem „jüdischen“ und dem „habsburgischen“ Wien beschäftigten sich die Studierenden auch mit dem „roten“ Wien, das anhand der Geschichte der SPÖ und dem wegen Bauarbeiten zu dieser Zeit geschlossenen Parlamentsgebäude gezeigt werden sollte. Zum Abschluss dieses Themas begaben sich die Teilnehmer der Exkursion anschließend zu den Karl-Marx Höfen; jenem Musterbeispiel sozialdemokratischer Wohnungspolitik der 1920er Jahre, in dem noch heute eine große Zahl Sozialwohnungen vermietet wird. Und wie sollte es auch anders sein — bekamen die Studierenden die Gelegenheit, dank einer alteingesessenen Bewohnerin den Komplex auch von innen zu erkunden. Dank der aufgeschlossenen Art der Bewohnerin war es den Studenten möglich, hautnah zu erleben, wie der Gebäudekomplex auch heute noch wie kein anderer dafür steht, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen ein Heim zu bieten. „Erstaunlich geräumig“ hieß es, als sie mit ihrer Besichtigungstour fertig waren.
Anderntags besichtigte die Wuppertaler Reisegruppe den Wiener Zentralfriedhof mit den Ehrengräbern der bekanntesten österreichischen Personen des öffentlichen Lebens. Beschäftigten sich die Studierenden und Lehrenden tagsüber noch intensiv mit didaktisch anspruchsvollen Beiträgen der anderen Exkursionsteilnehmer, ließen sie die Abende in belebter Atmosphäre bei gemeinschaftlichem Essen abklingen.
von Herrn Tomiak und Herrn Tahiri

Die Exkursion nach Berlin vom 20. bis zum 22. Juni 2019 war als integraler Bestandteil des Hauptseminars „Die deutsch-deutsche Grenze und ihre (musealen) Repräsentationen“ von Frau Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer konzipiert.
So wurden im Vorfeld der Exkursion in den Sitzungen des Seminars Erinnerungskonzepte, Probleme der Lesbarkeit von Symboliken, Authentifizierungs- und Emotionalisierungsstrategien erarbeitet und debattiert. Genau diese Aspekte waren dann auch die in den Museen und Gedenkstätten zu beachtenden.
Intensiv, aber durch die Dichte in guter Vergleichbarkeit, haben wir uns von der „Abfahrt“ im Tränenpalast am Bahnhof Friedrichsstraße bis zur „Ankunft“ im Aufnahmelager Marienfelde die unterschiedlichen Orte in der spezifischen Weise erschlossen.
Donnerstagmittag nach Ankunft in Berlin wurde mit dem Tränenpalast als Ankunfts-/Abfahrtsort begonnen. Frau Kraus stellte den Ort mit einer Kuratorenführung vor und nahm sich im Anschluss Zeit für ein ausführliches Gespräch hinsichtlich der aus dem Seminar erarbeiteten Aspekte.
Die Besichtigung der Bernauer Straße als historischem Ort und Gedenkstätte ergab eine autodidaktische Erschließung, die durch einen Guide ergänzt wurde.
Während des Abendessens tauschten wir die ersten Eindrücke des vergangenen und Erwartungen für den nächsten Tag in geselliger Runde aus.
Der Freitag beinhaltete das in Privatbesitz befindliche Mauermuseum „Haus am Checkpoint Charlie“ und im Anschluss die benachbarte Ausstellung BlackBox Kalter Krieg, die als Gegenentwurf zum Mauermuseum aufgenommen wurde. Die Konzeption der BlackBox stellte Frau Ganz vom Berliner Forum für Geschichte und Gegenwart e.V. vor und beantwortete unsere Fragen. Nach einer Mittagspause - fernab des üblichen Tourismus - wartete das Museum Ephraim-Palais mit der Sonderausstellung „Ost-Berlin - Die halbe Hauptstadt“, deren Schwerpunkt Leben und Alltag in Ostberlin ab den 1960er Jahren darstellt. Der Kurator, Herr Dr. Jürgen Danyel, erläuterte neben den genannten Aspekten auch inhaltlich ein erweiterndes Bild für die Wuppertaler Seminarteilnehmenden.
Den geplanten Abschluss bildete am Samstag die Erinnerungsstätte des Notaufnahmelagers Marienfelde, deren Konzeption Frau Steinhausen darlegte und die sich ebenfalls für ein intensives konzeptionelles Gespräch zur Verfügung stellte.
Die erlangten Eindrücke und weiterführenden Gespräche brachten uns auf die spontane Idee, als weitere Ausstellung des Kurators der BlackBox und des Tränenpalastes noch das Haus der Geschichte in Leipzig anzusteuern und dort die Dauerausstellung „Unsere Geschichte - Diktatur und Demokratie nach 1945“ hinsichtlich der Aspekte Authentizitäts- und Emotionalisierungsstrategien, Symboliken und dargestellte Narrative, zu erschließen.
Letztendlich planten wir während des Abendessens mit Blick auf die Alma Mater der Universität Leipzig auch noch einen kurzen Ausflug zum Völkerschlachtdenkmal, bevor der Rückweg nach Wuppertal eingeschlagen wurde.
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es für alle Beteiligten eine gelungene und spannende Exkursion war zwischen Erarbeitung der Spezifikationen von Ausstellungen, Gedenkstätten und Museen in Bezug auf die Repräsentationen der deutsch-deutschen Grenze und geselliger Stimmung, mit Gesprächen und Diskussionen, die über das gesetzte Exkursionsziel hinausgingen. Es bleibt das Wort der Exkursion zu küren: „Authentifizierungsstrategien“.

Am Pfingstmontag fand unter der Leitung von Steffi Grundmann und Gianna Hedderich eine Exkursion der Alten Geschichte in das LVR Römermuseum Xanten statt. In Verbindung zu den Kursthemen „Arbeit im Römischen Reich“ und „Augusteische Germanienpolitik“ wurde nach einer lehrreichen Führung durch die Handwerkerhäuser der archäologische Park besichtigt. Dabei konnten nicht nur die Grundzüge der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana erkannt, sondern durch die eindrücklichen Rekonstruktionsbauten auch Leben und Arbeiten in ihr nachvollzogen werden. Nach einem „römischen“ Mittagessen und dem Besuch der Schiffswerft standen abschließend das Museum sowie die Therme auf dem Programm.

Unter der Leitung von PD Dr. Arne Karsten und Dr. Jan Vondracek fand vom 24. bis 29. März eine Exkursion nach Rom statt. Sie schloss an das vorangegangene, von Herrn Karsten und Herrn Prof. Dr. Andreas Meier, auf der Exkursion aus Krankheitsgründen leider abwesend, veranstaltete Seminar „Goethe in Italien“ an, in welchem Goethes Italienreise der Jahre 1786/87 intensiv behandelt worden war.
Mit diesem Vorwissen konnte sich die aus Germanisten und Historikern gemischte Gruppe beherzt auf die Originalschauplätze dieser wohl berühmtesten Bildungsreise stürzen. Nachdem zum Aufwärmen zuerst der Petersdom besucht wurde, beleuchteten die Exkursionsteilnehmer, in vier Themengruppen gegliedert, Schwerpunkte von Goethes Romerlebnis.
So wurden am ersten Tag unter dem Thema „Goethes Antike“ die atemberaubenden antiken Gebäude und Plätze, wie das Forum Romanum, das Kolosseum oder das Pantheon bewundert. Am nächsten Tag standen unter dem Oberbegriff „Goethes Karneval“ das Stadtviertel Trastevere sowie ein Besuch der Casa di Goethe im Mittelpunkt. Tags darauf war „Goethes Barock“ an der Reihe. Die Chiesa Nuova und die Piazza Navona waren nur einige der vielen Highlights, bevor am letzten Tag noch einige Villen („Villegiatura“) außerhalb von Rom besucht wurden.
All diese Beiträge trugen dazu bei, dass die Gruppe ein tieferes Verständnis von Goethes Reise, des historischen Kontextes seiner Zeit, und nicht zuletzt von Rom als Stadt der Päpste entwickeln konnte. Zudem sorgte die intensive Gruppendynamik für eine abendliche Fortführung des historischen Flairs. Die Exkursionsneulinge bekamen von den Veteranen, anders als vor zwei Jahren, zwar kein tägliches Konklave samt Papstkrönung geboten, doch konnten sie dafür bei einem gemeinsamen Abend auf der Dachterrasse des Hotels Zeugen einer spätrepublikanischen römischen Senatssitzung werden, die als die Nacht der Klapp-und Pappmesser aller Voraussicht nach in die Geschichte eingehen wird.
Benjamin Pahnke

Vom 30.09.2018 bis zum 04.10.2018 besuchten 21 Student*innen der Bergischen Universität Wuppertal unter Leitung der Dozentinnen Dr. Juliane Brauer und Christine Dzubiel die ehemalige preußische Residenz- und Garnisonsstadt Potsdam. Besucht wurden nicht nur die preußischen Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie das Schloss Sanssouci und das neu aufgebaute Stadtschloss, sondern auch Orte, an denen wir der nationalsozialistischen und sozialistischen Vergangenheit der Stadt begegneten. Unter anderem arbeiteten wir im Gedenkort Leistikowstraße und setzten uns mit der Baustelle der Garnisonskirche und ihrem baulichen Umfeld auseinander.
Methodisch ging es um Exkursionsdidaktik und thematisch um das Konzept der Geschichtskultur, mit dem heute als bedeutsam eingeschätzte Orte analysiert werden können. Potsdam bietet sich dafür an, da dort aktuell lebhafte Diskussionen über die Traditionen der Stadt und ihre städtebauliche Sicht geführt werden. Zwischen dem (Wieder)Aufbau preußischer Schlösser und dem Abriss alter DDR-Gebäude steht die historische Identität der Stadt Potsdam im Zentrum der Auseinandersetzungen. Dabei wird auch verhandelt, wer und welches Geld hier die Diskurshoheit einfordert und erhält.
In der Vorbereitung der Exkursion teilten sich die Student*innen in Kleingruppen ein, um einen Ort in Potsdam vorzubereiten und dessen geschichtskulturelle Dimensionen mit der gesamten Gruppe vor Ort zu erarbeiten. Dadurch hatte jede*r die Chance, sich intensiv mit jedem Ort auseinanderzusetzen und sich eine eigene fundierte Meinung zu bilden. Diese führte mehrfach zu intensiven und emotionalen Diskussionen über die besprochenen Orte in der Gruppe.
Passend zum Tag der Deutschen Einheit traf man sich in Berlin zu den Feierlichkeiten. Aber auch an den anderen Abenden speisten wir zusammen in Restaurants oder trafen uns einfach in der Jugendherberge zu einer gemütlichen Runde Werwolf. Insgesamt war die Exkursion nach Potsdam sehr gelungen, was auch an der entspannten Atmosphäre zwischen Studierenden und Dozentinnen lag.
Marc Busch, Clemens Elsner

Foto: Sehriban Celik
Im Rahmen der Mittelalter-Vorlesung von Prof. Dr. Johrendt „Das karolingische Zeitalter“ und des von Frau Dzubiel angebotenen Seminars „Mittelalter im Geschichtsunterricht am Beispiel des Zeitalters der Karolinger“ fand am 7. Juni eine gemeinsam organisierte Exkursion von Teilnehmerinnen und Teilnehmern beider Lehrveranstaltungen nach Aachen zum Dom und der angrenzenden Domschatzkammer statt (wobei die Eisdiele um die Ecke nach einer ausgesprochenen Empfehlung von Herrn Johrendt nicht ausgelassen wurde).
In zwei Gruppen wurde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl durch die Ende des 8. Jahrhunderts unter Karl dem Großen errichtete Marienkirche als auch durch die Domschatzkammer geführt, welche zu den bedeutendsten kirchlichen Schatzkammern nördlich der Alpen zählt und zahlreiche und außergewöhnliche Kunstwerke, wie etwa den Proserpinasarkophag oder das Lotharkreuz, beheimatet. Sie erzählen von der über 1200 Jahre alten Historie des Aachener Domschatzes und gewähren Einblicke in die Geschichte der Liturgie. Besichtigt wurde ebenfalls der sich in der Chorhalle des Aachener Domes befindliche Karlsschrein, welcher zur Krönung Friedrichs II. 1215 fertiggestellt wurde und in dessen Inneren sich die Gebeine Karls des Großen befinden.
Die Führung durch Teile der von Karl dem Großen in Auftrag gegebenen königlichen Pfalz, die auch nach dem Tod des Kaisers als Herrschersitz fränkischer und ostfränkisch-deutscher Könige fungierte und über mehrere Jahrhunderte Krönungsort der römisch-deutschen Könige war, ließ die Studierenden Geschichte vor Ort begegnen. Durch die gemeinsame Lektüre des Berichtes zur Krönung Ottos des Großen bei Widukind wurde den Studierenden zudem vor Augen geführt, wie Karl der Große mit der Gründung seiner Pfalz und der Darstellung seiner Regentschaft seine Herrschaft zu legitimieren als auch zu inszenieren wusste, und damit auch die nachfolgenden Könige prägte.
Abschließend konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersuchen, wie die karolingische Geschichte im Aachener Stadtmuseum (im Centre Charlemagne) geschichtskulturell präsentiert wird.
Paul L. Reinke

Von Benjamin Döring und Fabian Schächt
Auf einer Exkursion im außergewöhnlichen Format einer Berufsorientierungsveranstaltung fuhren 5 Studierende unter der Leitung von Frau Dr. Heidi Hein-Kircher vom 20. bis 22.6.2018 nach Marburg und Hadamar. Eine thematische Ergänzung erfuhr die Exkursion durch die Besichtigung von Erinnerungsorten zu Elisabeth von Thüringen.
Der erste Tag in der Universitätsstadt Marburg stand im Zeichen der Digital Humanities. Digitale Anwendungen, wie zum Beispiel Präsentationen, Websites und Apps, sind schon heute Kanäle, über die vielfach geschichtliches Wissen vermittelt wird und solche werden, wie zu erwarten ist, zukünftig in allen Bereichen der angewandten Geschichte einen noch größeren Stellenwert erlangen. Um sich dieser Thematik zu stellen, nahmen die Exkursionsteilnehmer an einer Sitzung der Übung Geschichte im Netz – das Internet als Werkzeug von Dr. Eszter Gantner von der Philipps-Universität Marburg teil. Zwischen Wuppertaler und Marburger Studierenden entspann sich eine rege Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen von Videospielen als geschichtsdidaktische Instrumente. In einer zweiten Einheit ging es in der Übung um das Kennenlernen zweier Präsentationsprogramme, den Online-Tools Story-Maps und Prezi, mithilfe derer einige spontane Kurzpräsentationen entstanden. Leider finden trotz vielfältiger Gestaltungsoptionen und lernfördernder Optik solche PowerPoint-Alternativen bisher kaum Eingang in den fachinternen Diskurs der Geschichtswissenschaft, geschweige denn in deren Praxis. Am Abend wurde der Frauenberg in der Umgebung Marburgs besichtigt, auf dem die pittoreske Ruine einer Burg steht, welche Sophie von Brabant, eine Tochter der Heiligen Elisabeth, Mitte des 13. Jahrhunderts errichten ließ. Das Resümee am Ende des Tages war, dass die Beschäftigung mit den Anwendungsmöglichkeiten digitaler Techniken jedem Historiker und jeder Historikerin, die eine langfristige Tätigkeit innerhalb der Geschichtswissenschaft anstreben, angeraten sein sollte.
Am Donnerstag lernten die Exkursionsteilnehmer das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung auf dem Marburger Schlossberg kennen. Zunächst ging es um den institutseigenen Verlag, den Dr. Christoph Schutte den Studierenden vorstellte. Dabei befand der Redakteur die Schreibkompetenz der Autoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit als zentral. Er problematisierte, dass eingereichte Texte vielfach stilistisch unzureichend seien, und Selbstplagiate den Prozess akademischer Wissensgenerierung stören. Anschließend ging es in die Räumlichkeiten der Dokumentensammlung, die fast ausschließlich Archivalien zur Geschichte des Baltikums - vom Mittelalter bis zur Gegenwart - sammelt. Von den beiden Archiv-Mitarbeiterinnen, die beide ihren Beruf über den Quereinstieg gefunden haben, lernten die Exkursionsteilnehmer die verschiedenen Ausbildungswege und Einstiegsmöglichkeiten im Archivwesen kennen. Nach einer Mittagspause wurde das Bildarchiv begutachtet. Eine ganze Mannschaft Mitarbeiter*innen stand hier den Studierenden zur Verfügung. Der Abteilungsleiter Dr. Popp gab einen exemplarischen Überblick über den Bestand an Bildquellen, so z.B. polnische und tschechische Postkarten, die propagandistische Motive im Kontext des 1. und 2. Weltkriegs enthalten. Herr Popp plädierte für eine Verwendung von Bildquellen nicht nur zu illustrativen Zwecken, sondern auch als unmittelbares Quellenmaterial für historische Studien. Anschließend erhielten die Studierenden Einblicke in private Fotoalben von Wehrmachtsangehörigen und Mitgliedern der deutschen Besatzungsverwaltung, die Bilder aus den während des 2. Weltkriegs von Deutschland eroberten Ostgebieten gesammelt haben. Den Abschluss des Tages bildete eine Besichtigung des Marburger Schlosses, in dem ab 1263 Heinrich I., erster Landgraf von Hessen und Enkel Elisabeths von Thüringen, residierte.
Am nächsten und damit letzten Tag ließ die Gruppe Marburg hinter sich und wandte sich dem etwa 80 Kilometer entfernten Hadamar zu, wo als letzte Station der Exkursion ein Besuch der Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar anstand. Dort wartete Frau Dr. Esther Abel auf die Studierenden, welche in der Gedenkstätte als Historikerin für die schriftliche Überlieferung verantwortlich ist. Sie wies darauf hin, dass eine Möglichkeit des beruflichen Einstiegs in die Gedenkstättenarbeit das Volontariat sei. Frau Abel machte deutlich, dass aktuelle gesellschaftliche Debatten insbesondere die Gedenkstättenarbeit tangieren. In Hadamar sorgt die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des Krankenhauskomplexes als Tötungsanstalt bis in die Gegenwart für Spannungen unter der im Ort wohnenden Bevölkerung. Anschließend führte Frau Abel die Gruppe durch die im Obergeschoss liegende Ausstellung, die sich gleichermaßen mit den Tätern, sowie den Opfern auseinandersetzt. Zudem stellt die Ausstellung die Hintergründe der Nazi-Propaganda hinsichtlich der Euthanasie – besser bekannt als T4-Aktion – im Detail dar. Die Besichtigung der Kellerräume, in denen sich die Überreste vom Tötungsinstrument Gaskammer und des Krematoriums befinden, löste unter allen Exkursionsteilnehmern tiefe Betroffenheit aus.
Mit Vollendung dieses Rundgangs fand gleichsam eine facettenreiche Exkursion ihr Ende, in welcher die Studierendenschaft innerhalb von drei Tagen u.a. anhand von neuen in die Geschichtswissenschaft stoßenden Branchen wie Digital Humanities, verschiedensten klassischen Betätigungsfeldern, vom Archivwesen bis hin zur Gedenkstätte, eine Fülle von potentiellen Berufsmöglichkeiten veranschaulicht bekamen. So lässt sich diese Exkursion im Nachhinein als gelungenes – und folgerichtig als wiederholungsträchtiges – Projekt der Neueren und Neusten Geschichte in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik betrachten, mit dem Ergebnis, dass es in jedem Fall viele spannende und interessante Berufe auch jenseits des klassischen Lehrerberufs gibt.

Unter der Leitung von PD Dr. Arne Karsten fand vom 10. bis 16. März eine Exkursion nach Florenz statt, die ganz im Zeichen des Glanzes der vormodernen, italienischen Stadtrepubliken stand. Von Florenz ausgehend, stellten dabei die Studierenden an zwei Tagesausflügen nach Siena und Lucca die Sehenswürdigkeiten der Städte vor und erklärten ihre Bedeutung im Kontext der allgegenwärtigen Konkurrenz zwischen den italienischen Stadtrepubliken des Mittelalters und der Frühmoderne.
An den anderen Tagen durchstreifte die Gruppe die Medici-Metropole und konzentrierte sich dabei auf die, auch im toskanischen Dauerregen, beeindruckenden Palazzi der reichen und mächtigen Familien der alten Stadt am Arno. Ein Besuch des Kunsthistorischen Instituts Florenz, wo besonders das große Archiv an Fotografien beeindruckend wirkte und in dem über die Möglichkeit eines Praktikums an dieser bedeutenden geisteswissenschaftlichen Forschungsinstitution informiert wurde, rundete das offizielle Programm passend ab.
Insgesamt sieben Tage verbrachte die Gruppe der Bergischen Universität in Florenz. Aus diesen Tagen nahmen die Teilnehmer der Exkursion neben den Eindrücken der beeindruckenden Kirchen und Palazzi in Florenz, der Piazza del Campo Sienas und der vollständig erhaltenen Stadtmauer Luccas (um nur einige der zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu nennen), noch etwas anderes, ganz besonderes mit: Nach einem Spiel des AC Florenz vor nasser, doch beeindruckender Kulisse, kehrte die Gruppe mit einer neuen Fan-Liebe wieder zurück ins ebenso nasse und beinahe genauso beeindruckende Wuppertal. Forza Fiorentina!

Vom 12. bis 15. Oktober 2017 traf sich die aus dem vorjährigen Studienkurs unter Leitung von PD Dr. Arne Karsten und Prof. Dr. Dietrich Erben (TU München) hervorgegangene Nachwuchsforschergruppe zur Diskussion ihrer Forschungsergebnisse in Venedig. Zum Thema des gemeinsamen Projekts „Tod eines Staates. Der Untergang der Republik Venedig 1797 im Spiegel der europäischen Presseberichterstattung“ wurden von den Teilnehmer/innen ausgewählte Zeitungen der wichtigsten europäischen Metropolen 1797 in den Blick genommen. Die damit verbundenen Erkenntnisse konnten dank der Förderung durch die Fritz Thyssen Stiftung am Deutschen Studienzentrum Venedig im Palazzo Barbarigo della Terrazza in anregendem Rahmen erörtert und weitergedacht werden.
Im Zuge dieser Vortragsreihe beschäftigten sich Marion Dotter, Sabrina Herrmann, Linus Rapp, Luise Marie Willer und Johanna Ziebritzki sowie die beiden Studierenden der Bergischen Universität Wuppertal Nina Scheuß und Michael Schwedt mit der Wiener Zeitung und Preßburger Zeitung, der Vossischen Zeitung, dem Münchner Intelligenzblatt und der Kurfürstlich gnädigst privilegierten Münchner Zeitung, der London Times, dem Mercure der France sowie der visuellen Darstellung des Untergangs der Serenissima. Deutlich zu Tage trat dabei die zentrale Rolle der Presse nicht nur als berichterstattendes Medium, sondern auch und gerade als politisches Instrument. Dessen Wirksamkeit im Einzelnen in den Blick zu nehmen war nur einer von vielen Erträgen dieses Nachwuchsforscherworkshops, die nunmehr zur Publikation vorbereitet werden sollen.

Danzig bietet sich, als für Deutsche und Polen eine gleichermaßen geschichtsträchtige Stadt, für eine Exkursion nur so an. Die ehemalige Hansestadt besuchten 11 Student*innen und 4 Dozent*innen der Bergischen Universität Wuppertals vom 2. Oktober bis zum 8. Oktober 2017 unter der Leitung von Fr. Dr. Agnes Laba und Fr. Christine Dzubiel. Die Leitthematik der Exkursion „Die Deutsch-Polnischen Beziehungen“ wurde anhand der Geschichte Danzigs und seiner Umgebung präsentiert und diskutiert.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten Danzigs wurden besucht; die malerischen Langgasse, die Solidarność Werft und ihr Museum sowie die Polnische Post sind nur einige jener. Nicht nur die Stadt Danzig/Gdansk, sondern auch die nähere Umgebung hat die Gruppe besichtigt. Das Kloster der Zisterzienser in Oliva, der ehemalige Hauptsitz des Deutschen Ordens die Marienburg und das Ostseebad Sopot waren alle nach einer kurzen Bahnfahrt erreichbar. Durch das Zusammenwirken der Lehrgebiete „Neuere und Neueste Geschichte“ und „Geschichte und ihre Didaktik“ wurde stets auch der didaktische Aspekt der Exkursion betont.
Ungeachtet dessen, welch enorm wichtige Stellung die Besichtigung geschichtsbedeutsamer Orte darstellt, kristallisierte sich der größte Gewinn der Exkursion im Austausch untereinander heraus.
Die gemeinsamen Abendessen dienten als Plattform für ausgiebige Gespräche zu unterschiedlichsten Themen. Einzigartig ist daran der Kontakt zwischen Personen, die sich im universitären Alltag kaum begegnen würden. Der Austausch über das täglich Erlebte bot einen wichtigen, aktuellen Anlass, um unter anderem die Manifestation des Rechtsrucks in Polen zu reflektieren – angefangen bei Widerstandssymbolen des Zweiten Weltkrieges, über nationalistische Symbole auf T‑Shirts in Souvenir-Shops, zu Grabmälern von ehemaligen Regierungsmitgliedern in Kirchen unter Abbildungen der Schwarzen Madonna.
Herauszuheben bleibt auch der Besuch im Museum des Zweiten Weltkrieges, das durch seine durch die aktuelle polnische Regierung gewollte Transformation der Ausstellung symbolisch für den Anlass der Exkursion steht.
Rückblickend lässt sich eine Exkursion wie diese nur empfehlen. Die unzähligen Bereicherungen, die der Aufenthalt in einem anderen Land bringt, lassen sich nur schwierig in diesem Bericht verdeutlichen. Zwischen der Freude, einerseits über das teils wunderschöne Danzig und die unterhaltsamsten Situationen, die durch die gemeinsame Zeit entstehen, und andererseits dem Erschrecken über exklusive Repräsentationen, wie Plakate zum gemeinsamen Beten an den Außengrenzen Polens, bietet ein Aufenthalt seine Erfahrungen, die wir jedem Studenten und jeder Studentin wünschen.
Besonderer Dank gilt Fr. Dr. Laba und Fr. Dzubiel, die mit ihrem Einsatz den Aufenthalt spannend und vielseitig gestalteten.
Bericht von Clemens Elsner und Florian Reisslandt

Auf der Venedigexkursion des historischen Seminars bot sich den Studenten vom 9.12. - 11.12.2015 ein anschaulicher Einblick in die Forschungspraxis durch die Teilnahme an einer Tagung am Deutschen Studienzentrum in Venedig (www.dszv.it). Auf der Fachtagung hatten die Studenten die Chance, zahlreichen Vorträgen zum Thema „Venedig als Bühne – Organisation, Inszenierung und Wahrnehmung europäischer Herrschaftsbesuche“ beizuwohnen. Die Beiträge der Tagung, die unter anderem von Prof. Dr. Jochen Johrendt organisiert wurde, handelten von der Zeit der frühen Karolinger bis zu den Prunkregatten im 17. und 18. Jahrhundert. Die große Bandbreite der Beiträge eröffnete dementsprechend zahlreichen, epochenübergreifenden Diskussionsstoff, der auch von uns Studenten mitgeprägt wurde. Im Kaminzimmer des Palazzo Barbarigo della Terrazza, Sitz des Deutschen Studienzentrums in Venedig und ausgestattet mit einer einladenden Terrasse, die einen unvergleichlichen Ausblick auf den Canal Grande bietet, konnten zahlreiche neue Erkenntnisse zum Tagungsthema gewonnen werden.
Doch der Ertrag der Exkursion wäre zu kurz gekommen, wenn nur das Zusammentreffen im Palazzo betrachtet würde. Die mitgereisten Wuppertaler Professoren Arne Karsten und Jochen Johrendt führten die Studenten in der freien Zeit zielstrebig an bedeutende Orte der Serenissima. Der Dogenpalast, die Scuola Grande di San Rocco oder die Frarikirche – es sind nur einige Sehenswürdigkeiten der Markusrepublik, welche Professoren und Studenten gemeinsam besuchten, betrachteten und anschließend in historischer Manier analysierten. Dabei ging trotz tiefwinterlicher Temperaturen das Interesse an den künstlerischen Besonderheiten der Stadt und das harmonische Miteinander nie verloren.
Typisch kulinarisch endete die Exkursion dann auch am 12.12. mit einem gemeinsamen Abendessen, bei dem die venezianische Küche noch einmal ausgiebig getestet wurde. Die Exkursion ermöglichte den Studenten auf diese Weise einen exemplarischen Einblick in die Arbeit eines Historikers sowie in Kultur und Geschichte Venedigs fernab vom Universitätsalltag.
Niklas Bründermann

21 Studierende des Historsichen Seminares wie der Latinistik erkundeten Mitte September die Lagunenstadt. Geleitet wurde die Exkursion von Prof. Dr. Jochen Johrendt und Prof. Dr. Arne Karsten.
Das Leitmotiv der Exkursion "Mythos Venedig" wurde epochenübergreifend an den Kirchen und Palästen der Stadt studiert und diskutiert. Neben den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, wie etwa dem Dogenpalast oder dem Markusdom, war der Besuch am Deutschen Studienzentrum im Palazzo Barbarigo ein Höhepunkt der Reise.
Lesen Sie hierzu auch den Exkursionsbericht.

Im Rahmen des Hauptseminars "Die Königin im Frühmittelalter", das in diesem Semester am Historischen Seminar von Prof. Dr. Jochen Johrendt angeboten wird, fand am 25. Mai eine Tagesexkursion nach Köln zur Ausstellung "Königinnen der Merowinger. Adelsgräber aus den Kirchen von Köln, Saint-Denis, Chelles und Frankfurt am Main" statt.
Die Kommilitoninnen und Kommilitonen wurden durch die Ausstellung von dem ehemaligen Leiter der Domgrabungen Dr. Georg Hauser geführt, der die die Befunde eindrucksvoll einbettete. Besonders interessant war dabei das Grab der 540/541 gestorbenen und gemeinsam mit einem 7-jährigen Knaben bestatteten merowingischen Königin Wisigarde, deren Grab 1959 unter dem Chor des Kölner Doms entdeckt wurde. Die durch Dr. Hauser zum "Sprechen" gebrachten Fundstücke aus den Gräbern dieser und anderer Königinnen (Wisigarde, Arnegunde und Balthild) verdeutlichten den Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmern die hohe Relevanz realienkundlicher Funde als Ergänzung für die in der Regel stark textorientierte Quellenarbeit von Historikerinnen und Historikern vor allem in quellenarmen Zeiten wie der des Frühmittelalters.
Ermöglicht wurde die Exkursion dankenswerterweise durch eine finanzielle Zuwendung des Gleichstellungsbüros der Bergischen Universität Wuppertal.

Exkursion mit Prof. Dr. Tönsmeyer und Jan Vondráček, M.A.
30 Geschichts-Studierende der Bergischen Universität Wuppertal besuchten Mitte Juni die Gedenkstätte Auschwitz. Unter Leitung von Historikerin Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer und ihrem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Jan Vondráček M.A. trafen sie sich zu einem Zeitzeugengespräch mit Prof. Dr. Wacław Długoborski. Der polnische Historiker ist Auschwitz-Überlebender und langjähriger Leiter des wissenschaftlichen Beirats der Gedenkstätte Auschwitz.
Im Rahmen ihrer Exkursion besichtigten die Wuppertaler Studentinnen und Studenten das ehemalige Stammlager sowie das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. „Ein Ort, der wie wohl kaum ein anderer das Grauen, das sich mit der Shoa verbindet, unmittelbar vermittelt“, so Prof. Tatjana Tönsmeyer. Im Anschluss an die Besichtigungen wurden die Eindrücke in intensiven Reflexionsrunden diskutiert und eingeordnet.
Die Exkursion fand statt im Rahmen des Seminars „Das System der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager 1933-1945“. Sie wurde finanziell unterstützt durch die Stiftung „Erinnern Ermöglichen“.